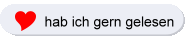geschrieben 2025 von Stevie Tagwerker (Stevie Tagwerker).
Veröffentlicht: 23.07.2025. Rubrik: Abenteuerliches
Das Mantra der Schwebefliegen
Das Mantra der Schwebefliegen
Nachdem Herwig den gestrigen Sonntag in das kathartische Zeichen des Alkoholausschwitzens gestellt hat, wacht er an diesem Montagmorgen mit neuen Lebensgeistern versehen auf. Ein herrliches Gefühl! Das Schuljahr zu Ende, die Ferien stehen erst am Anfang, mehrere Wochen keine Verpflichtungen, außer jenen, die er sich selbst auferlegt hat, und das sind nicht gerade viele. In den Sommermonaten zieht er sich gerne zurück, genießt es, in den Tag hineinzuleben, dem eigenen Biorhythmus zu folgen. Jener Tag, an dem sich am Horizont der Beginn des neuen Schuljahres erkennen lassen würde, würde früh genug kommen. Herwig steht schwungvoll auf, torkelt dennoch etwas schlaftrunken durch die nächtlich ausgekühlte Hütte in Richtung Badezimmer, um sich zu erleichtern und mit eiskaltem Wasser zu kultivieren. Er stirbt noch kurz den kleinen Tod, danach Müsli, Kaffee, Dreiviertelhose, Shirt, Softshelljacke, Bergschuhe. Der kleine Rucksack ist schnell gepackt: Frisches Shirt, Trinkflasche, Müsliriegel. Er verschließt die Türe in der aufgehenden Sonne hinter sich und macht sich auf den Weg Richtung Magdalena Quell, einem verwunschenen kleinen Wallfahrtskirchlein, das einst wildromantisch in den Berg gezimmert wurde. Herwig durchschreitet das hohe Gras zur Pforte des Waldes, noch nass vom Tau der vergangenen Nacht. Die gesamte Blumenwiese schlummert noch, aber in Kürze würde sie nach und nach erwachen. Er betritt den Wald auf einem kleinen Pfad, schon mehr zugewachsen als ausgetreten und wie der alte Parkplatz in der Lärcheneggerkehre fast schon in Vergessenheit geraten. Leicht ansteigend unter einem schattenwerfenden Blätterfirmament und zwischen Nadelbaumsäulen, Farnen und Huflattichen mäandert das Weglein dahin. Langsam setzt Herwig einen Fuß vor den anderen, es ist kein Grund zur Eile geboten. Legte er den Weg bis zum Eingang der Klamm in normalem Tempo zurück, wäre er nach einer guten Stunde am Fuße der Schlucht angelangt, er aber nimmt sich die doppelte Zeit für seinen Weg. Die Physis kann so zum einen langsam warmlaufen, zum anderen ist er etwas anders gestrickt als die meisten Menschen, die sich ähnlich wie Pferde, auch in deren Freizeit wie vor eine Kutsche gespannt, samt Scheuklappen von wem oder was auch immer von A nach B scheuchen lassen, ohne nach rechts und links zu blicken. Immer wieder mal bleibt er stehen, beobachtet, wie sich Farne ganz langsam mehr und mehr dem heller werdenden Tageslicht öffnen, wie Eichkätzchen nicht minder schnell in die Gänge kommen, wie Ameisen auf ihren Haufen scheinbar chaotisch und doch geordnet herumwuseln. Hier hat er das Gefühl, dass alles genau seinen Platz hat, kein Grashalm, kein Baum, kein Schmetterling, kein Käfer, kein Vogel, kein noch so unbedeutsam erscheinendes Wesen ist umsonst. Als hätte hier einst das Paradies die Welt berührt. Es herrscht friedliche Ordnung. Auf halbem Wege beginnen links erst kleinere Steine, dann immer größer werdende Felsen aus dem Boden zu wachsen, einige moosgescheckt. Nach und nach setzt unaufdringlich Vogelgezwitscher ein. Das Blätterdach des alpinen Urwalds sperrt einen beträchtlichen Teil des Lichts unseres brennenden Zentralgestirns aus. Die hohen Bäume beanspruchen das meiste davon für sich selbst. Und an jener Stelle, an der die ersten steinernen Riesen beginnen emporzuwachsen, um dann mit den anderen Gefährten seit Jahrmillionen zu Felswänden zu verschmelzen, kann man, etwas Stille vorausgesetzt, das Rauschen der unzähligen Wasserfällchen aus der Ursusklamm hören, das von der kühlen Brise des Sommermorgens von Baum zu Baum getragen wird. Herwig lächelt. Da ist sie wieder, die Vorfreude, bald würde er am Eingang der Klamm stehen. Metronomisch erhöht das Rauschen den Takt seiner Schritte, wie in Trance legt er den noch vor ihm liegenden Weg zurück. Die Flora wird dichter, der Pfad verschwindet mehr und mehr unter Gestrüpp und Geäst. Er müht sich etwas unbeholfen durch das Dickicht, das Rauschen immer deutlicher in seinen Ohren. Das Grün und Braun weicht sonnenbeschienen steinigem Uferboden, der ins kalte klare Nass übergeht, einer großen Gumpe, in der sich das Wasser aus der Klamm sammelt, um dann seinen Weg weiter nach unten ins Tal, geradewegs in seine Bestimmung des ewigen Kreislaufs, fortzusetzen. Betreten verboten – Lebensgefahr! steht ausgewaschen auf einem Schild geschrieben, auf einen etwas morschen Pflock genagelt und von den aerosolen Ausläufern der Klamm gezeichnet. „Jaja, das Leben. Lebensgefährlich“, murmelt Herwig in seinen Stoppelbart. Er zieht sich Schuhe und Socken aus, setzt sich ans eisige Wasser und steckt seine Füße vorsichtig hinein. Ihm entfährt der leise Schrei eines siebenjährigen Mädchens, er blickt sich um, stellt sicher, dass ihn niemand gehört hat. Er füllt seine fast schon leere Aluflasche mit dem kalten Gebirgswasser, nimmt einen Schluck und legt sich nach hinten. Hier, auf Stein und Sand, wo die Bäume nicht wurzeln können, funkelt die Morgensonne, eine Vormittagssonne schon, und lässt das Nass glitzern. Sowohl Ort als auch Zeit sind ideal, um eine kleine Pause einzulegen und dem Rundherum sein Gehör zu schenken. Herwig schließt seine Augen und lässt sein Gesicht vom Sonnenlicht umschmeicheln, während er immer tiefer in das Rauschen hineinlauscht. Nach wenigen Minuten beginnt sich das Rauschen zu verändern, es wird vielschichtiger. Die Vielschichtigkeit wird durch eine Unzahl von kleinen und kleineren Kaskaden komponiert. Wenn man einen Bach rauschen hört, hört man erst mal nur das Rauschen. Nimmt man sich aber Zeit, wirklich Zeit, und das ist es, was Herwig jetzt tut, und lauscht man tiefer hinein, erkennt man, dass das Rauschen die Symphonie eines ganzen Orchesters in High Definition wiedergibt. Von den Kaskaden oberhalb, wo das Wasser seit Jahrhunderten und Jahrtausenden damit zubringt, Steine zu schleifen, Jahr um Jahr, Tag um Tag, Nanometer um Nanometer abzutragen und jedes mikroskopisch kleine Partikel als Teil, als unbedeutend kleines Teil, den Ozean eine Nuance salziger macht, das Rauschen, mehr als nur das, viel mehr, ein intensives Gluckern an der Schwelle zum Rauschen, sich in Gumpen ergießend und in ein Gebirgsbachrauschen mündend, aber doch kein Tosen, wie man es von großen Wasserfällen kennt, aber immerhin, um in einem etwas breiter und flacher verlaufenden Bachbett, wenige Meter lang nur, durch einige harrende Steine eine zarte Irritation der Wasseroberfläche auszulösen, bis zu jener Stelle, wo das Ganze ein lieblich säuselndes Plätschern nach sich zieht. Das Bild eines Mikrotsunamis baut sich vor Herwigs geistigem Auge auf. Durch das Hören blickt er tiefer in die fluviatile Choreographie, er meint, kleine Pferde mit schaumig wehenden Mähnen in den kleinen Fluten auszumachen. Um dann einige Gluckser weiter einen Meter senkrecht abzufallen, rechts und links von Felswangen in die Zange genommen. Die Zange selbst das Ergebnis von Naturschauspielen, von Regen und Schnee, von Eis und Hagel, von Blitz und Donner, von den unzähmbaren Kräften des fließenden und fallenden Wassers, von Sonne und Hitze geformt, seit, ja, seit wann eigentlich? Wann hatte das Schleifen, das Abtragen, das Auseinanderbrechen, das Gefressenwerden, das Gluckern, Glucksen, Säuseln, Plätschern und Rauschen und irgendwo anders als hier begonnen? Die Umschreibung älter als die Zeit selbst wäre wohl zu hoch gegriffen, aber auf jeden Fall nahm das alles vor langer Zeit seinen Lauf. Vor sehr langer Zeit. Und heute, Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende und Jahrmillionen später, ein orchestrales Rauschen. In jedes einzelne Rauschen, Gluckern, Glucksen, Plätschern und Säuseln kann man genau hinein hören, und wenn man, wie Herwig in diesem Moment, die Aufmerksamkeit isoliert über einen längeren Zeitraum auf ein einzelnes Rauschen, Gluckern, Glucksen, Plätschern oder Säuseln lenkt, hört man die Geschichten, die das Wasser durch die Ursusklamm herunterträgt, Geschichten seiner unendlichen Reise. Das Rauschen daneben erzählt eine andere Geschichte als das Glucksen darüber und das Plätschern darunter. Jede einzelne Stelle reimt ihre ganz eigene Ballade. Und alle trachten danach, einander zu übertönen. Nicht in Lautstärke, in Intensität aber und Melodik, mancherorts auch in Dramatik, und immer resultierend in perfekter Harmonie. All diese Geschichten lassen Herwig in ein seichtes Dösen driften, wenige Minuten nur. Er öffnet die Augen und rappelt sich hoch, nimmt seine Füße aus dem Wasser, streckt die Zehen durch. Er zieht sich Socken und Schuhe wieder an und blickt aufwärts. Die ersten hundert Meter, das Portal, gleichsam mystisch wie warnend, wiederum gemächlich ansteigend, ehe es gut zweihundert Holzleitern und Steighilfen, die einen senkrecht nach oben ragend, die anderen schräg zur nächsten Steighilfe wachsend, zu überwinden gilt. Ein Höhenunterschied von sechshundert Metern, rechts der Ursusmauer hoch. Er nimmt noch einen großen Schluck Wasser und steckt seine Flasche in den Rucksack, den er beidseitig schultert. Ehrfürchtig durchschreitet er die Pforte, keine zwei Meter breit, links und rechts stehen Felswände Spalier. Ausgesperrtes Sonnenlicht, ausgesperrte warme Luft. Dafür weht ihm hier ein kühler und feuchter Wind um die Ohren. „Hier weht ein anderer Wind“, lacht er mit sich selbst, und denkt an all die pädagogischen Drohungen, die im Laufe eines Lebens gehört wie ausgesprochen werden. Noch besser gefallen ihm Floskeln wie „Dann rauscht’s“, „Dann lernst du mich kennen“, „Das wirst du dann schon sehen“, „Dann hörst du das Rauschen im Walde“ oder „Lang schau ich mir das jetzt sicher nicht mehr an“. Am liebsten aber mag er die Drohung „Ich zähle jetzt bis drei“. Manifeste der Hilflosigkeit. Er erreicht die ersten Steigleitern, die nach all den Jahren noch immer einen robusten Eindruck machen. Seit es hier immer wieder mal Steinschläge und Felsstürze gab, bei denen auch Menschen ums Leben gekommen sind, ist die Klamm für alle gesperrt, daher werden die Leitern und Tritthilfen auch nicht mehr instandgehalten. Die Mannschaften, die die Steighilfen und Geländer ursprünglich gebaut haben, haben aber einen gründlichen Job gemacht. Unter ausgehöhlten, nassen, moosbewachsenen Felsen bahnen sie sich ihren Weg durch die Schlucht hinauf, umweht von kleinsten Wasserteilchen, die seit Langem immer tiefer in den Kern der Rundhölzer gepeitscht werden, vorbei an kitschigen Kaskaden, über die das Wasser purzelt. Schon zu Beginn ist etwas Trittsicherheit gefragt, die gischtüberzogenen Hölzer sind heimtückisch rutschig. „Immer dorthin blicken, wo du gehst“, sagt Herwig, „wenn du dir etwas genauer anschauen willst, stehenbleiben, verweilen, schauen, und erst dann weiter gehen“, mahnt er sich selbst. Fürwahr, dies ist kein Weg für Wallfahrer und Pilger. Die kommen alle über die andere Seite des Berges zum Kirchlein, eine alte Zahnradbahn schnauft einmal täglich dampfend nach oben. Dort brauchen die Besucher, viele unter ihnen schon mehr als angejahrt, lediglich auszusteigen, zehn Minuten bergab zu wackeln, und schon können sie ihre Kerzlein anzünden, ihre Gebetlein sprechen, Fotos machen und wieder umkehren. Da am gestrigen Sonntag großer Pilgertag mitsamt Messe war, werden am heutigen Tag wohl kaum Besucher zu erwarten sein. So kann Herwig davon ausgehen, das Ziel für sich alleine zu haben. Er ist alleine. Passieren darf hier nichts, wenn doch, stirbt man bestenfalls schnell, schlimmstenfalls langsam, aber jedenfalls alleine. Immer wieder bleibt er an relativ sicher scheinenden Stellen, etwa unter grottenartigen Felsausbuchtungen, stehen, um die Schönheit der Schlucht zu bestaunen. Exponierte Passagen, wo die Steighilfen die Schlucht queren, bringt er schnellstmöglich hinter sich, ohne dabei zu hasten. Wie Orry Main einst sagte: Hast und Eile treiben einen in den Tod. Stellen, an denen die Leitern beinahe senkrecht verlaufen, wechseln mit welchen, die Herwig fast horizontal durch die Schlucht leiten, ab. Verwunschene Ecken, in denen sich Feen, Elfen und Trolle herumzutreiben scheinen, die sich jetzt kurz zurückziehen, um Herwig passieren zu lassen. Damit sie anschließend wieder tun können, was immer sie so tun, hier, zwischen ausgewaschenen Felsen mit dunkelgrünen Grasbüscheln, die dem Wasser, das sie nach und nach formt, nichts entgegenzusetzen haben als Zeit. Herwig ist inzwischen etwas durchnässt, Feuchtigkeit dringt mit langsamer Vehemenz durch seine Kleidung, und so wasserabweisend seine Softshelljacke auch ist, das Wasser scheint diese Eigenschaft mit einer Selbstverständlichkeit zu ignorieren, wie es nur eines der vier Elemente vermag. Feuchtigkeit treibt es auch aus Herwigs Haut, obwohl es recht kühl in der Schlucht ist. Das Durchsteigen dieses Naturjuwels ist eher auf der schweißtreibenderen Seite angesiedelt. Sonnenlicht lässt sich irgendwo wieder erahnen, es wird schleichend etwas heller, was bedeutet, dass Herwig dann doch irgendwann im Begriff ist, im oberen Bereich der Klamm anzukommen. Es sind noch etwa zehn Leitern zu bewältigen, ehe der restliche Weg, der nach draußen führt, ohne Steighilfen auskommt. Leider muss Herwig erkennen, dass eine der Leitern nicht mehr da ist, ein Felssturz dürfte sie in die Tiefe gerissen haben. Ungläubig und etwas verärgert geht er zu jener Stelle, an der sich eine horizontale Kluft von etwa drei Metern, plus minus, zu einem Sims nassen Grases auftut, eine gestreckte Körperlänge darober die nächste intakte Leiter. Klingt jetzt erst mal nicht unmachbar, ein Sprung von drei Metern. Wenn aber die Anlaufmöglichkeit zum Absprung begrenzt ist, ist das das eine. Dass der Sprung über einen Abgrund führt, das andere, doch das ist eine Frage des Mindsets. Bei der Tatsache aber, dass die Landung punktgenau auf wenigen Zentimetern rutschiger Unterlage, direkt auf eine Felswand, an der man sich besser blitzschnell festkrallt, sitzen muss, stellt sich schon ein gewisser Schwierigkeitsgrad ein. Würde das aber hinhauen, nur mal angenommen, wäre es durchaus umsetzbar, nach oben zu greifen und sich an der rettenden Leiter festzuhalten. Jetzt ist es aber so, dass diese zwar vertikal gesehen oberhalb erreichbar wäre, nur eben einige Meter weiter rechts ruht. Und zwischen dieser punktgenauen Landezone und ebendieser Leiter nasser Fels. Schon mit der einen oder anderen Griffmöglichkeit, aber die problematischen Faktoren läppern sich da jetzt schon zusammen. Und immer die Gewissheit, dass weiter unten sensenwetzend Gevatter Tod wartet. Herwig setzt sich, um seine Optionen abzuwägen. Umkehren wäre wohl das Vernünftigste, aber dazu hat er überhaupt keine Lust. Darauf, den Sprung zu wagen, sich irgendwie zur nächsten intakten Leiter zu hangeln, mit den recht klobigen Bergschuhen dabei Halt auf dem nassen Gras zu suchen und auch zu finden und den rutschigen Felsen entlang zu schlüpfen, fast ebenso wenig. Fast. Seine Statur entspricht zwar in keiner Weise der eines Jakob Schubert oder der einer Jarna Garnbret, für die diese Kluft keine Herausforderung, sondern eher eine Aufwärmübung wäre, er ist sich aber sicher, dass er es schaffen könnte. Er müsste die Sache nur gewissenhaft und vorbereitet angehen. Er sieht sich die Griffmöglichkeiten am Felsen so genau an, wie es ihm möglich ist, versucht abzuschätzen, welche für seine kräftigen und massiven Finger in Frage kommen und welche eher seinen Tod bedeuten würden. Erst also den rechten Fuß auf das Gras, gleichzeitig die Felskante mit der linken Hand umklammern, nachrücken. Den rechten Arm nach rechts strecken, volle Streckung nicht notwendig, an der kleinen Gratung festhalten, linkes Bein vorne am rechten vorbeischieben, dabei nirgends den Halt verlieren, den Fels um nichts in der Welt loslassen, ehe der linke Fuß nicht halbwegs sicher am Boden wäre, bestenfalls in die Kerbe gedrückt, die sich zwischen dem Gras und dem unteren Felsende auftut. Dort, an dieser Stelle, wo ein Stück an der Unterseite des Felses ausgeschlagen ist, könnte er sein angewinkeltes Knie verkeilen, sein massiver Oberschenkel dürfte kaum Spiel haben, perfekt, um dort zu verweilen und abzuchecken, wie die nächsten Schritte aussehen könnten. Währenddessen dürfte er mit dem anderen Bein etwas Halt auf dem Sims finden. Mit dem rechten Bein also nachrücken, das Knie angewinkelt in die Ausbuchtung drücken. Die größte Sorge bereitet ihm der letzte Abschnitt. Ein mittelprächtiger Sprung würde ihn die Hölzer, die es zu erreichen gilt, fassen lassen, aber dazu wäre ein halbwegs fester Untergrund schon hilfreich. Den er aber kaum haben würde. In einem Klimmzug wiederum sieht er kein Problem. „Ja, das könnte funktionieren“, sagt er, „schön wäre, wenn ich das Hindernis mit zehn Klimmzügen überwinden könnte, dann wäre ich schon lange drüben.“ Er sinniert noch über die Alltagstauglichkeit seines Sports nach, den Kniebeugen, dem Bankdrücken, den Klimmzügen, den Schulterpressen, dem Klopfen und Schlagen der Battlerope. „Vielleicht hätte ich mich für eine andere Sportart entscheiden sollen. Kletterkompetenz wäre jetzt angesagt. Andererseits, hätte ich mich damals nicht für Kraftsport, sondern für Radfahren oder Joggen entschieden, wäre mir jetzt auch nicht geholfen. Hätte ich mich aber für das Klettern entschieden, täte ich mir jetzt leichter und wäre schon drüben. Hätte ich, täte ich, wäre ich. Recht viele Konjunktive. Und mit Konjunktiven kommt man im Leben nicht weiter, so viel ist fix“, spricht er sich selbst Mut zu, was vom permanenten Rauschen des Ursusbachs verschluckt wird. Er steht auf, checkt sein Schuhwerk, nimmt einen Schluck Wasser und tritt an den Rand des Abgrunds. Seinen Rucksack wirft er schwung- wie kraftvoll voraus, er landet tatsächlich dort, wo er soll. Er vermeidet den Blick nach unten, stellt sich stattdessen vor, all das wäre eine Übung im Turnsaal der Schule, ein Geschicklichkeitsparcour aufgebaut aus Matten, Kästen, Böcken, der direkt zur Sprossenwand führt und den er seinen Schülern demonstriert. Vormachen, nachmachen, wie es sich seit jeher gehört. Er tritt zurück, zwei Meter Anlauf, mehr hat er nicht. Kurz schließt er die Augen, atmet durch. Erster Schritt kraftvoll, beim zweiten explodiert er von der Kante, fliegt steinbockgleich über den Abgrund. Sein rechter Fuß kommt einen Sekundenbruchteil vor dem linken auf dem rutschigen Gras auf, gleichzeitig ergreifen seine beiden Hände ohne Plan und Ziel den Fels. Überraschenderweise steht, hängt Herwig recht stabil da. Kurze Schnappatmung, geschlossene Augen. „Ruhig. Ganz ruhig“, atmet er das Schnappen weg. Er öffnet seine Lider, aber wagt es nicht, nach unten zu blicken. Vorsichtig gleitet sein rechter Fuß den Sims entlang, es ist rutschiger als erhofft, aber griffiger als erwartet. Gleich danach umklammert er mit seiner linken Hand, den Unterarm kraftdurchädert, den Felsen an einer geeigneten Stelle. Entschlossen, trotzdem mit gebotener Vorsicht, rückt er nach, setzt das linke Bein unmittelbar neben das rechte, streckt seinen rechten Arm nach der kleinen Gratung aus, es ist tatsächlich nötig, diesen voll zu strecken. Überraschend sicher schiebt er sein linkes Bein jetzt vorne am rechten vorbei, schmiegt sich dabei, den Bauch einziehend und „Ich sollte weniger Süßigkeiten essen“ stammelnd an den Felsen, so gut es geht. Kaum ist der linke Fuß auf dem rutschigen Boden bestmöglich in der Felskerbe zwischen Gras und Stein verankert, zieht er mit seinem rechten Bein nach, schwingt sein Knie in die Ausbuchtung des Felsens, winkelt es an und spannt seinen Oberschenkel. Binnen weniger Momente gewinnt der an Umfang und verkeilt so sein Bein in der kleinen Höhle. Beinahe gleichzeitig greift er mit seiner linken Hand neben seine rechte und findet, wieder überraschend sicher, Halt, ohne sich großartig anstrengen zu müssen. Kurz überkommt ihn der Gedanke, einen Blick nach unten zu wagen, schüttelt diesen aber ab. Herwig weiß, würde er nach unten sehen, würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Panik über ihn hereinstürzen, er würde sich verhaspeln und in die Tiefe stürzen. Der gerade stattfindende Tanz mit dem Sensenmann reicht völlig, da muss er ihn nicht zusätzlich noch provozieren. Kurz bereut er, dass er nicht umgekehrt ist. Aber nur kurz. Herwig stellt sich vor, er hänge an der Sprossenwand im Turnsaal der Pradler Mittelschule, wenige Zentimeter unter ihm eine blaue Turnmatte. Er findet seinen Fokus wieder, sieht sich die Möglichkeiten der nächsten Griffe und Schritte genau an und erkennt schnell, dass sich diese stark in Grenzen halten. Nichts davon ist mit der Größe seiner Finger kompatibel, er kann nur noch eines tun. „Großartig“, rinnt ihm der Schweiß übers Gesicht, „jetzt muss ich einen auf Tom Cruise machen!“ Er führt seinen linken Arm über seinen rechten, an eine von Wind und Wetter abgeschliffene Felsecke, umklammert diese, so fest es geht. Er löst die Verkeilung seines rechten Beins in der Ausbuchtung, versucht wiederum, auf dem nassen Gras Halt zu finden, rutscht kurz ab, aber mit einem Reflex, der eigentlich jüngeren Semestern vorbehalten ist, gelingt es ihm, doch noch relativ sicher zu stehen. Die Sonne ist in diesem Moment hoch genug gestiegen, um ihm einige ihrer Strahlen hoffnungsvoll und mutzusprechend auf das nicht mehr ganz so dicht mit Haaren bewachsene Haupt zu werfen, und er schiebt sein linkes Bein ein weiteres Mal vorne an seinem rechten vorbei. Wieder rückt er nach. Und mit einem Kraftakt springt er, das rechte Bein voraus, zielgenau auf die abschüssige Kante des grasbewachsenen Bodens und stößt sich, blitzschnell wie kraftvoll, die beiden Arme nach oben Richtung Leiter streckend, ab. Wie im Lehrbuch illustriert erreicht Herwig die runden Hölzer, hat jedoch unterschätzt, wie rutschig sie sind. Sein Gesicht rot vor Anstrengung spürt er ihn, den Gevatter, wie der ihn an seinen Fußsohlen kitzelt. Ihn nach unten ziehen will. Und dann spürt er nichts mehr. Keine Fragen mehr. Keine Antworten mehr. Nur noch zwei Möglichkeiten. Klimmzug oder Fall. Sein oder Nichtsein. Leben oder sterben. Aber so ist das: Wenn man ein Abenteuer erleben will, und wenn man diese Aufhebung aller Fragen erleben will, dann muss es Abgrund unter einem geben, dann muss es die Todesgefahr als Möglichkeit geben. Herwig atmet zweimal ein und aus, füllt seine Lungen mit Luft, mit so viel Luft, wie er nur kann und zieht sich unter einem langen Schrei, dem Urschrei gleich, nach oben, das Festhalten erfordert viel mehr Kraft als der Klimmzug an sich. Er bekommt mit der rechten Hand eine der Verstrebungen zu fassen, ergreift diese auch mit der linken, zieht sich eine halbe Körperlänge mehr nach oben und bleibt kurz liegen, in einem Moment der flüchtigen Sicherheit, in dem er genügend Halt findet, sich kurz auszuruhen, gleichzeitig ein Moment, in dem noch gar nichts vorbei ist, da seine Beine hüftabwärts noch immer in der Luft baumeln. Er arbeitet sich weiter nach oben, bis er vollständig auf der recht eben verlaufenden Leiter neben seinem Rucksack zum Liegen kommt. Er dreht sich auf den Rücken. „Den Weg zurück werde ich dann auf der anderen Seite antreten“, sabbert er, „mit der Zahnradbahn, ist glaub ich besser so“, und lacht erleichtert. Ihm ist danach, seine Arme siegreich nach oben zu strecken, doch dafür schmerzen sie zu sehr. Auch wenn sich sein Pulsschlag schnell wieder verlangsamt, so bleibt er doch eine gute Viertelstunde liegen, ehe er sich aufmacht, den restlichen Weg hinter sich zu bringen. Er überwindet, wenngleich etwas wackelig, auch die letzten Meter der Klamm, steigt über das Geländer und sieht auch hier ein Warnschild, das die Pilger davon abhalten soll, von hier weiter nach unten abzusteigen. Recht viele scheinen bis zu diesem Schild vorzudringen, der Pfad, der nach oben zum Magdalena Quell führt, ist von hier weg stark ausgetreten. Er blickt nach oben und sieht die kleine Kirche wie eine hölzerne Trutzburg in den Felsen thronen. Dunkelbraun lackiert, einige Balken wie auch die Fensterrahmen in einst strahlendem Weiß, das nach und nach ermattet, hervorgehoben, dahinter Fels, teilweise von Bäumen bewachsen. Herwig nähert sich seinem Ziel nun scheinbar mühelos, zwei leichte Steigleitern trennen ihn vom Wallfahrtsort. Nicht, dass er sich irgendwie als Wallfahrer sieht, er kann auch mit Religion im Allgemeinen und mit dem Katholizismus im Speziellen recht wenig anfangen, kann aber genauso wenig abstreiten, dass sich in ihm in letzter Zeit eine etwas spirituellere Seite aufgetan hat. Primär sieht er in diesem Ort einen der Ruhe, der inneren Einkehr, und wann immer er in oder vor diesem Kirchlein sitzt, das wirkt, als hätte es Leonardo Da Vinci in die Felsen gepinselt, findet er etwas mehr zu sich. Das erste Mal seit zwei Jahren ist er wieder hier und nimmt erstmal auf einer der Bänke vor dem Kirchlein Platz. Er wechselt sein T-Shirt. Hängt das nassgeschwitzte, nachdem er es ausgewrungen hat, auf eine der Zaunlatten. Er setzt sich wieder, schlingt alle drei Müsliriegel runter. Er lässt seinen Blick schweifen. Ein Ort voller Geschichte, zu dem es kaum Aufzeichnungen gibt, fast alles hierüber wurde über Jahrhunderte mündlich überliefert. Ein Volksschullehrer hat alles alte Wissen darüber vor mehr als hundert Jahren zusammengetragen und eine Chronik erstellt. Die Vermutung geht davon aus, dass die Wallfahrten im zwölften Jahrhundert ihren Ursprung haben, nach mehreren Heuschreckenplagen und einem für diese Breiten ungewöhnlich schweren Erdbeben. Eine Legende erzählt von einem Ross, das sich in den Felswänden der Ursusspitze verstiegen hat und daraufhin abgestürzt, einige Tage später aber unversehrt aufgefunden worden ist. Und just an jener Stelle ist ein Bild der Heiligen Maria Magdalena erschienen, neben einem Felsspalt, der in jenem Moment aufgebrochen ist und seither einen unterirdischen Gebirgsbach ans Tageslicht führt. Die Geschichte hat schnell die Runde und den Ort binnen kürzester Zeit – welchen Zeitraum auch immer man damals unter dieser Begrifflichkeit verstanden haben mag – als einen Platz der Gnade Gottes bekannt gemacht, der nun auch mit Heilkräften versehenes Wasser offenbart. Aber erst im achtzehnten Jahrhundert ist mit dem Bau einer Kapelle begonnen worden. Die Großgrundbesitzer, laut Volkssage die Nachkommen eines unerschrockenen wie listigen Drachentöters, haben das notwendige Holz wie auch die Arbeiterschaft zur Verfügung gestellt. Nach der Fertigstellung um 1725 ist das Gotteshaus geweiht worden, um knapp hundert Jahre zu überdauern, ehe ein Felssturz eines Nachts den Großteil binnen weniger Sekunden zerstört hat. Daraufhin hat man entschieden, die Kapelle zwanzig Meter weiter, außerhalb der Gefahrenzone, neu zu errichten. Wiederum hat die Familie, die bis heute Eigentümerin des Waldes ist, Material und Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt. Drei Jahre später, im September 1825, ist der Einweihungsgottesdienst begangen worden. Und heute hegt und pflegt ein Verein das Gebäude, welches in wenigen Wochen seinen zweihundertsten Geburtstag feiern würde. Herwig steht auf und schlendert Richtung Eingang, zehn hölzerne Stufen führen hinauf zum Kapellenschiff. Ein Votivbild zeigt die Heilige Maria Magdalena schwebend, das Haupt umringt von einem riesigen Heiligenschein, in der Stube eines Bauernhauses, unter ihr eine Bäuerin auf Knien, daneben eine Holzwiege, in der ein Kleinkind liegt. Und in Frakturlettern steht geschrieben: Eine Mutter verlobte sich zur allerseeligsten Maria Magdalena, wegen den heftigen Fraisen ihres Kindes, und erlangte augenblicklich Hilfe. Daneben Maria Magdalena von Heiligkeit beschienen in den Wolken, darunter ein einfach gekleideter Mann auf Knien, die Hände gefaltet. Aus dankbarer Erinnerung der Heilung des Christian Stiggleggers, welcher durch einen Unfall sein Aug verloren hätte, durch die Fürbitte zur Heiligen Maria Magdalena wieder gesund geworden, im Jahr 1846. Gewidmet von seiner Schwester Johanna. Darunter Balthasar Tiefbock vulgo Isser ist am 6. Juli 1874 beim nachhause fahren von St. Josef spät abends samt 2 Pferde in das durch Hochgewitter angeschwollene Wasser gefallen. Durch die Fürbitte Magdalena Quell ist er unverletzt samt den Pferden beim Leben erhalten worden. Mehr als zwanzig solcher Dankesmemoiren über kleine Wunder hängen im Eingangsbereich des Kirchleins, mehr einer warmen und großen Holzstube denn einem Gotteshaus gleichend. Vielleicht gefällt Herwig dieser Ort eben deswegen so gut, wegen dieser offenkundigen Dankbarkeiten wem oder was auch immer gegenüber, die im Laufe der Jahrhunderte hierhergetragen worden sind. Es ist kein Ort der allseits gepredigten menschlichen Unwürdigkeit, kein Ort der immerwährenden Reue, kein Ort meiner Schuld, meiner Schuld, meiner riesengroßen Schuld. Auch Herwig ist dankbar darüber, hier zu sein. Vor etwas mehr als einem Jahr hat er dem Tod selbst ins Auge geblickt, im Klassenzimmer seiner 4b. Und darauf ist er nun wirklich nicht vorbereitet gewesen. In letzter Sekunde hat sich der Sprühnebel aus Blut aus dem Kopf jenes Schülers, der gerade dabei war, ihn mit einer Glock 19 über den Jordan zu befördern, über Herwigs Gesicht verteilt. Der Polizist vom SECTOR Innsbruck ist, dem Himmel sei Dank, einen Augenblick schneller gewesen und der Teenager mit aufgerissenen Augen vor Herwig und der verschanzten Klasse leblos zusammengesackt. Dagegen scheint jetzt die Kletterpartie von vorhin wie ein schweißtreibendes Hobby zum Zwecke der Adrenalinproduktion mit anschließendem Dopaminrausch. Noch immer etwas high genießt er den Aufenthalt auf dem heiligen Boden, sieht sich alles zum wiederholten Male genau an, liest jedes einzelne Wort jeder einzelnen Danksagung, als lese er es zum ersten Mal. Leicht zeitverloren packt er sein Shirt, das fast schon trocken ist, in seinen Rucksack und macht sich dann doch auf den Weg nach oben. Die Sonne hat ihren Zenit für heute bereits überschritten und er glaubt sich zu erinnern, dass die Bahn am frühen Nachmittag die Station Richtung Tal verließe. Er setzt einen Fuß auf die erste Stufe der letzten Steigleiter, die nach oben zur alten Bahnstation führt, als er wenige Meter über sich etwas hört. Er blickt hoch. „Jö, eine Gams!“, flüstert er, erkennt aber beim zweiten Hinsehen, dass es ein junger Steinbock ist, der sich ihm in den Weg stellt. In jenem Augenblick, in dem er Herwig registriert, beginnt er zu strullern, von wegen Revier markieren und so. Herwig senkt respektvoll seinen Blick, um den Bock nicht zu provozieren, weiß, dass er in dieser Situation keine Chance hätte, sollte das Tier seinen harten Schädel samt jungen, aber doch schon imposanten Hörnern gegen ihn einsetzen wollen. „Ganz ruhig, mein Junge“, sagt Herwig mit beruhigender Stimme. Der Bock stampft mit seinen Vorderhufen vehement auf. Mehrere Minuten stehen sich die beiden gegenüber, Herwig weicht immer wieder ganz langsam zurück. Dann sieht der Steinbock Herwig noch kurz an, wendet sich ab und springt davon. Herwig schreitet demütig und in sich gekehrt nach oben. „Das wär’s jetzt noch gewesen“, spricht er mit sich selbst. Auf dem Bergrücken hört er etwas Ähnliches wie ein Summen, allerdings in hundertfacher Ausführung. Ein Flirren. Er verlässt den Weg, steigt den Bergrücken entlang etwas hoch durch den Wald. Wenige Minuten nur, dann steht er am Rand einer runden Lichtung. In der Mitte eine hochgewachsene Lärche. Um diese Lärche herum hunderte Schwebefliegen auf mehrere Stockwerke verteilt. Ausgerichtet auf das Zentrum des Baumes schweben sie reglos im windstillen Raum, bewegen sich, bis auf das Flügelschlagen, nicht. Wie meditierende Mönche, die um ein Allerheiligstes sitzen. Mit einer enervierenden Konstanz windet sich das Flirren in Herwigs Gehörgänge, dringt tiefer und tiefer ein, dann, mit einem Schlag, wirkt es beruhigend. Klingt wie ein Mantra, das sie Herwig mit auf den Weg geben wollen. Aufmerksam lauscht er, dann drehen sich die Schwebefliegen geisterhaft in seine Richtung, richten ihre Längsachsen langsam auf ihn aus. Sie bewegen sich langsam auf ihn zu. „Das ist dann wohl der Zeitpunkt, mich zu verabschieden“, meint Herwig. Er dreht sich um und schreitet, etwas schnelleren Schrittes, zurück auf den Weg. Als er den erreicht, überquert er den Bergrücken wie ursprünglich geplant, spaziert jetzt auf der sonnigen Seite zur Bahnstation, wo die alte Zahnradbahn, bereits Dampf aus ihrem Schlot stoßend, zur Abfahrt bereitsteht. Er geht zum Lokführer, da niemand sonst anwesend ist, bei dem er ein Ticket hätte kaufen können. Dieser winkt aber nur ab und meint: „Steig ruhig ein, ich glaube ja nicht, dass auf dem Weg nach unten irgendwo ein Kontrolleur aufspringt.“ Herwig lacht und bedankt sich. „Ein kleiner Obolus ist aber fällig, für die Kaffeekasse, sonst kann ich nicht losfahren“, fordert ihn der alte Lokführer jetzt ernsterer Miene auf und untermalt das Gesprochene mit einem kurzen Zusammenkneifen eines Augenlids. Herwig drückt dem Mann eine Münze in die Hand. Der Alte lüftet kurz seine Mütze und bedankt sich. Herwig nimmt im hinteren der beiden offenen Waggons, die an Schönwettertagen wie diesen gezogen werden, Platz, wirft zum ersten Mal, seit er die Hütte verlassen hat, einen Blick auf sein Telefon. Das Gespann setzt sich in Bewegung. Ein Anruf in Abwesenheit, eine nicht eingespeicherte Nummer mit Haller Vorwahl. Die alte Bahn setzt sich langsam schnaufend in Bewegung, Herwig betätigt die Rückruftaste, in einer Hand das Telefon, die andere Hand das freie Ohr zuhaltend. „Hallo? Herwig Trenker hier“, ruft er mehr in das Telefon, als dass er spricht, „Sie haben heute Vormittag versucht, mich zu erreichen?“
„Ach ja, hallo Herwig, hier spricht Robert Steixner, Mittelschule Hall.“ Herwig begrüßt den Direktor seinerseits. „Ich wollte dir nur mitteilen, dass das Schulamt deinem Versetzungsantrag stattgegeben hat. Du bist also ab September Teil unseres Lehrerkollegiums.“
„Das sind fantastische Nachrichten, Robert, ich danke dir. Wann soll ich mich denn bei dir melden?“, will Herwig wissen, „ich bin derzeit in den Bergen im Süden unterwegs.“
„Das eilt nicht, Herwig. Melde dich einfach im Laufe der letzten Ferienwoche. Genieß die Ferien und willkommen an unserer Schule“, antwortet Robert.
„Mach ich, du auch, vielen Dank!“
Herwig reißt, nachdem er aufgelegt hat, die Hände freudig nach oben. Er lehnt sich wieder zurück, genießt die majestätische Aussicht, während der Bummelzug aus einer anderen Zeit ihn gemütlich in der Nachmittagssonne ins Tal bringt. Er checkt noch seine Nachrichten, da ist eine vom Direktor der Mittelschule Pradl I, Konrad Meier. „Musste gerade zähneknirschend zur Kenntnis nehmen, dass du dich hast versetzen lassen. Schöne Ferien.“ „Alles klar, du Vollpfosten“, werden Herwigs Worte vom sich wieder und wieder wiederholenden und auf ganz eigenartige Weise dumpfen Tschtschtschtschtschtsch verschluckt.
(von Stevie Tagwerker)
 2x
2x