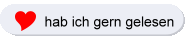Veröffentlicht: 19.08.2025. Rubrik: Grusel und Horror
Schatten der Ewigkeit - Dämonenjäger Valerius von Falkenberg jagt Vampirfürstin Rumanja Katadka
Hinweis zur Entstehung der Geschichte
Die nachfolgende Geschichte basiert vollständig auf meiner eigenen kreativen Vorstellungskraft. Zur Ausarbeitung nutze ich ein KI-gestütztes Schreibwerkzeug, dem ich meine Ideen – darunter Figuren, Schauplätze, Atmosphären, Ausrüstungsdetails sowie einzelne Dialoge – übermittle. Die KI hilft mir dabei, diese Elemente in eine zusammenhängende und literarisch ausgearbeitete Erzählung zu verwandeln.
Noch ein kleiner Hinweis: Ich bin ganz neu im Geschichten schreiben und mach das einfach, weil’s mir Spaß bringt. Ideen hab ich jede Menge – und wenn mich die Laune packt, setz ich sie einfach um.
41.554 Wörter / 258.615 Zeichen / 119 A4 Seiten / Lesedauer zirka 208 Minuten
Schatten der Ewigkeit: Dämonenjäger Valerius von Falkenberg jagt Vampirfürstin Rumanja Katadka
Vorgeschichte
Prolog:
Die Stille vor dem Sturm
Sibirien. Ein Kontinent aus Eis, größer als jede Hoffnung. Der Wind jagte wie eine geisterhafte Bestie über das endlose Weiß, wirbelte Schneeflocken auf, bis sie wie Millionen winziger, rasender Dolche durch die Luft schossen. Jeder Atemzug schnitt wie Glas, jeder Schritt knirschte auf einem gefrorenen Boden, der selbst das Sonnenlicht verschlang.
Zwischen gezackten Felsen, die wie die Zähne eines schlafenden Ungeheuers in den Himmel ragten, hatten sich drei Gestalten gefunden – doch nur zwei waren lebendig. Theodora von Falkenberg stand aufrecht, den Umhang schwer von Schnee, in ihren Augen glomm ein Wille, so scharf wie das Schwert in ihrer Hand. Neben ihr, die Schultern angespannt und den Blick unablässig auf die Dunkelheit gerichtet: Valerius, ihr Sohn. Kaum dreiundzwanzig Winter alt, und doch trug er in den Zügen die Härte von jemandem, der mehr Schatten als Sonnenlicht gesehen hatte.
Ihnen gegenüber: Rumanja Katadka. Die Schattenfürstin. Eine Frau, deren bleiche Schönheit von einer Unheil bringenden Anmut durchzogen war – und deren Augen funkelten wie schwarzes Eis über einem bodenlosen Abgrund. In der Hand hielt sie keine gewöhnliche Waffe. Ihre Klinge war ein uralter, schwarz gehärteter Säbel, in dessen Aderungen getrocknetes Blut aus Jahrhunderten gefangen war. Als sie sprach, trug der Wind ihre Stimme wie das Heulen einer Verlorenen durch die Weite.
Rumanja (leise, wie ein Versprechen und ein Fluch zugleich): „Ihr kommt weit gereist… nur um zu sterben.“
Theodora (kalt, den Griff ihres Langschwerts fester ziehend): „Einer von uns wird heute hier bleiben. Und ich habe nicht vor, dass es mein Sohn ist.“
Kapitel 1: Die Geburt der Schattenfürstin
Das Jahr 431 v. Chr. – weite Steppen in Zentralasien, dort, wo die Gräser im Sommer wie grüne Flammen leuchteten und im Winter wie Glas splitterten. Rumanja Katadka war zu jener Zeit eine Fürstin von unangefochtener Macht, geboren im Herzen eines stolzen Reitervolkes. Sie ritt einen schwarzen Hengst, dessen Augen fast so unruhig funkelten wie ihre eigenen. Unter der Sonne glänzte ihr langes, kohlschwarzes Haar wie eine Fahne. Männer verstummten, wenn sie den Blick hob. Frauen senkten die Augen, aus Respekt – und aus Furcht.
Ein alter Schamane des Stammes, mit Bart so weiß wie alter Knochenstaub, hatte ihr einst prophezeit: „Dein Herz ist eine Quelle. Es kann Leben spenden – oder alles ertränken.“ Rumanja hatte gelacht. Dieses Lachen würde Jahrtausende später noch in den Knochen derer klingen, die sich ihr widersetzten.
In jener verhängnisvollen Neumondnacht stand sie am Rand eines Waldes, der älter war als jede menschliche Erinnerung. Die Stille war so vollkommen, dass selbst der Schnee es wagte, ohne Laut zu fallen. Aus der Schwärze zwischen den Stämmen drang ein Wispern, süß und schneidend zugleich:
„Opfere, und ich gebe dir Macht, die nie vergeht…“
Was dann folgte, war ein Gemetzel, das die Götter zum Schweigen brachte. Rumanja schritt durch das Lager ihres eigenen Volkes, die Hand fest um den Griff des Säbels, dessen Klinge im Feuerschein wie flüssiges Quecksilber schimmerte. Kein Schrei wurde zu Ende geführt; sie war schneller. Als der Morgen graute, war ihr Lager ein Meer aus Blut, und wo einst eine Frau gestanden hatte, regte sich nun ein Wesen, das nicht mehr dem Lauf der Zeit gehorchte.
Kapitel 2: Das Erbe der Falkenbergs
Jahrhunderte später, in einer Welt aus flackerndem Kerzenlicht und dem Geruch alter Bücher, begann die Geschichte der Falkenbergs. Theodora wuchs zwischen verstaubten Bänden und kalten Stahlwaffen auf, in einer Villa in den Karpaten, deren Fundamente älter waren als jedes Kirchenregister.
Schon als Kind hörte sie in stillen Nächten Geräusche, die andere für Einbildung hielten – das Kratzen von Fingern an Fenstern, Flüstern hinter Mauern. Ihr Vater lehrte sie den Gebrauch des Rapier, ihre Mutter das Lesen alter Bannformeln.
Doch erst, als sie die Legende der Schattenfürstin in einem vergilbten Pergament fand, wusste sie: Das ist mein Feind.
Sie verfolgte die Spur Rumanjas von Alexandria, wo sie angeblich ganze Händlerfamilien auslöschte, bis zu den Wäldern Siebenbürgens, wo Dörfer flüsterten, man habe eine Frau gesehen, deren Augen wie flüssiges Schwarz glühten.
Valerius, ihr Sohn, wurde schon mit zwölf an den Kampf gewöhnt. Er konnte eine Armbrust blind laden, trug stets eine silberne Klinge bei sich und wusste, dass Knoblauch mehr war als ein Küchenkraut.
Kapitel 3: Das Duell im Eis
Die Reise nach Sibirien begann im Herbst, als das Eis zu wachsen begann wie ein zweites Herz der Erde. Ihre Ausrüstung war karg, aber tödlich:
• Theodoras Waffe: Ein Zweihänder mit einer Klinge aus Meteoreisen, in Runen geätzt, die nur im Mondlicht lesbar waren.
• Valerius’ Arsenal: Eine handgefertigte Armbrust mit Bolzen aus Eschenholz, deren Spitzen in geweihtem Silber getränkt waren. Dazu ein Jagdmesser mit Hirschhorngriff.
• Ritualgegenstände: Glasphiolen mit geweihtem Wasser, eine mit Drachenblut getränkte Lederschlinge, und ein kleiner kupferner Spiegel, um Gestaltwandler zu entlarven.
Als sie die letzte Anhöhe erklommen, stand Rumanja bereits dort – eine Silhouette im Treiben des Schnees. Der Wind zerrte an ihrem schwarzen Seidenumhang, der aussah, als wäre er aus der Nacht selbst gewebt. Ihre Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, das zu scharf war, um menschlich zu sein.
Rumanja: „So, die Falkenbergs… immer noch wie lästige Mücken.“
Valerius (fauchend): „Heute stirbt eine von uns. Und es wird nicht meine Mutter sein.“
Theodora (flach, aber fest): „Valerius, keine Wut. Präzision.“
Dann zerbarst die Stille. Der erste Schlag Rumanjas war schnell wie ein Gedanke. Theodora parierte, Funken stoben in den Schnee. Valerius löste einen Bolzen – Rumanja drehte sich, und der Pfeil schnitt nur ihren Umhang.
Der Kampf wurde zu einem Taumel aus Licht und Schatten, Stahl und Blut. Und als Rumanjas Klinge Theodora traf, war es, als würde die Welt für einen Moment stehen bleiben.
Theodora (flüsternd, zu Valerius): „Lauf. Vollende es… für mich.“
Valerius rannte, während der Schnee unter seinen Füßen knirschte wie berstende Knochen. In seinen Händen hielt er das Jagdmesser, und in seinem Herzen einen Schwur, der härter war als jede Klinge.
Die Jagd des Valerius von Falkenberg
Kapitel 1: Der Schatten über Wien
Drei Monate waren seit Theodoras Tod vergangen. Drei Monate, in denen Valerius von Falkenberg jede Nacht wie ein Gefangener der Vergangenheit verbrachte, jede Stunde ausgehöhlt vom brennenden Hunger nach Rache. Der Schmerz war nicht mehr dieser grelle, messerscharfe Stich – er hatte sich verwandelt in etwas Schweres, Dunkles, das wie ein Gewicht auf seiner Brust lag und ihn zwang, tiefer zu graben… tiefer in das Wissen, das Menschen nicht kennen sollten.
Das verborgene Archiv, in dem er sich verschanzt hatte, lag unter den alten Gassen Wiens, dort, wo sich die Stadt in eine Welt aus muffigen Gängen und schimmeligen Gewölben verwandelte. Die Mauern waren krumm wie vom Atem uralter Legenden verbogen, jede Ritze schwarz vor Feuchtigkeit. Über dem groben Stein kroch ein Moos, das sich feucht unter den Fingern anfühlte, als würde es leben. Das einzige Licht kam von einer rußigen Öllampe, deren Glas blind vor Alter war. Das trübe Flackern ließ die Schatten wie schwarze Schleier an den Wänden zittern – und manchmal schien es Valerius, als würden diese Schleier Gesichter formen.
Der Geruch war ein Gemisch aus modernden Büchern, kaltem Stein und einer Spur Weihrauch – ein altvertrauter Hauch, der von den Ritualen seiner Mutter blieb. Sie hatte diesen Ort „Refugium“ genannt – für ihn jedoch war er längst zu einem Grab ihrer Geheimnisse geworden.
Valerius saß an einem Tisch, dessen Holz so alt war, dass jeder Kratzer eine Geschichte erzählte. Darauf lag ein unübersichtliches Chaos: Pergamentrollen mit brüchigen Kanten, in Leder gebundene Folianten, Karten, deren Tinte fast verblasst war. Die Karte vor ihm jedoch zog seinen Blick immer wieder an – eine Karte der Welt, nicht so, wie die Menschen sie kannten, sondern durchzogen vom Reich der Schatten.
Rote Nadeln stachen in verschiedenen Ländern hervor – ein unsichtbarer Weg, der sich wie ein Faden aus Blut und Jahrhunderten durchzog. Jede Nadel ein Ort, an dem die Fürstin Rumanja Katadka gesehen worden war. Valerius’ Blick wanderte über die Linie. Sie war keine Reisende… sie war eine Jägerin, geduldig, zielgerichtet, lauernd.
Er murmelte leise, als würde er versuchen, die Fäden des Netzes zu entwirren: „Bukarest… 1783. Prag… 1864. Wien… 1912. Sie folgt einem Muster, Theodora… ich weiß nur noch nicht, welchem.“
Die Erinnerung an Theodoras Stimme traf ihn wie ein kalter Windstoß – sanft, doch durchdringend. „Die Wahrheit liegt im Schatten, Valerius. Aber sei gewarnt: Manche Schatten verschlingen mehr, als du ertragen kannst.“
Er blätterte in einem weiteren Bündel Pergamente, bis seine Hand an einem besonders zerbrechlichen Stück innehielt. Die Ränder fransten aus, der Geruch war beißend – wie verschlossenes Leid, das sich über Jahrhunderte in Fasern eingebrannt hatte. Darauf: die Zeichnung eines Amuletts.
Das Herz der Schatten.
Es war von einer Schönheit, die beunruhigte – schwarze Edelsteine, die im Licht der Lampe funkelten, als würden sie atmen. Die Linien der Zeichnung waren so fließend, dass sie aussahen, als hätten sie sich selbst auf das Pergament geschrieben.
Und dann – am Rand – die krakelige Handschrift seiner Mutter:
„Rumänien. Karpaten. Legende: verborgen in einem Kloster, das der Welt entfallen ist.“
Er starrte darauf, während die Kälte des Gewölbes sich tiefer in seine Knochen schlich. Das war kein bloßer Hinweis. Es war eine Wegmarke.
„Rumänien also…“ flüsterte er, und seine Stimme klang fremd, als würde jemand anderes durch ihn sprechen.
Da knackte es hinter ihm. Holz. Langsam drehte er den Kopf.
In der Dunkelheit des Ganges stand eine Silhouette, nur angedeutet vom Schein der Lampe. Sie bewegte sich nicht, aber Valerius konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass sie ihn anstarrte.
„Wer ist da?“ Seine Stimme war jetzt messerscharf.
Schweigen. Nur ein leichtes Rascheln.
Er griff unter den Tisch und zog ein Jagdmesser hervor – die Klinge, matt geschwärzt, um kein Licht zu werfen.
„Ich wiederhole mich nicht,“ knurrte er.
Da trat eine Gestalt ins Licht: schmal, in einen abgewetzten Reiseumhang gehüllt, ein Gesicht, dessen Augen wie zwei Messerklingen funkelten.
„Beruhige dich, Falkenberg,“ sagte sie mit einer Stimme, die wie Rauch klang. „Ich bin nicht hier, um dich zu töten.“
Valerius’ Griff um das Messer lockerte sich nur minimal. „Das werden wir sehen. Wer bist du?“
Die Frau trat näher. Der Duft von nassem Leder und kaltem Wind hing an ihr. „Mein Name ist Irina Dacrescu. Und wenn es stimmt, was man über dich sagt, jagen wir die gleiche Beute.“
Ein leises, trockenes Lächeln stahl sich auf Valerius’ Gesicht. „Rumanja.“
„Richtig.“ Irinas Blick fiel auf das Pergament mit dem Amulett. „Und wenn du leben willst, solltest du wissen: Das Herz der Schatten ist kein Werkzeug. Es ist eine Tür. Manche, die es öffneten, sind nie zurückgekehrt.“
Sie setzte sich einfach gegenüber, ohne gefragt zu werden. Ihre Hände legten einen feuchten Umschlag auf den Tisch – darin Kartenfragmente, verblasste Zeichnungen, Symbole in einer Sprache, die selbst Valerius nur bruchstückhaft verstand.
„Woher hast du das?“
„Man kann in Wien viel finden… wenn man weiß, wo man zu suchen hat. Aber ich bin nicht hier, um dir meine Lebensgeschichte zu erzählen. Ich bin hier, um dir zu sagen: In den Karpaten bist du nicht allein unterwegs. Die Berge sind… auf ihrer Seite.“
Ein leises Lachen schlich sich in Valerius’ Kehle. „Berge fressen keine Männer.“
Irina neigte den Kopf, ihre Augen blitzten. „Oh, Falkenberg… diese schon.“
Das Flackern der Lampe schien plötzlich stärker zu werden, als würde eine unsichtbare Bewegung in der Dunkelheit das Licht beunruhigen. Beide blickten reflexartig zur Tür, die sich lautlos ein Stück öffnete.
Ein Hauch drang herein – wie der Atem von etwas, das draußen in der Nacht wartete.
Valerius legte das Pergament zurück in die Truhe. „Dann pack deine Sachen. Wir reisen im Morgengrauen.“
Irina erhob sich, schob den Stuhl geräuschlos zurück. „Morgengrauen, ja… wenn es das noch gibt, bis wir dort ankommen.“
Die Tür schloss sich, aber der Schatten, der sich in der Ecke des Raumes regte, blieb.
Kapitel 2: Ein Hauch von Rumänien
Die Reise nach Rumänien war nicht einfach lang – sie war ein zähes, endloses Gleiten durch eine andere Zeit. Valerius saß allein im Abteil eines alten, klappernden Waggons, dessen Wände nach altem Holz, Öl und einer Spur Moder rochen. Mit jeder Bewegung des Zuges knarrten die Sitzbänke wie gealterte Knochen. Draußen peitschte der Winterwind gegen die Fensterscheiben, und dünne, gezackte Eiskristalle bildeten ein wirres Netz auf dem Glas, als hätten unsichtbare Finger Spuren hineingeritzt.
Sein Gepäck lag auf der gegenüberliegenden Bank – ein Anblick, der ihm Sicherheit gab. Er wusste, dass jedes dieser Artefakte eine Geschichte in sich trug:
• Das lange Silberschwert, dessen Klinge im Lampenlicht schimmerte wie gefrorenes Quecksilber.
• Zwei Dolche mit gesegnetem Stahl, deren Kanten matt und gefährlich wirkten.
• Eine Reihe kleiner Glasphiolen, die träge funkelten wie eingefangene Sternensplitter – Elixiere, deren Rezepturen nur er kannte.
• Ein Bündel Knoblauch, das überraschend geruchlos war, und doch war allein seine Anwesenheit wie ein Bann gegen das, was kommen mochte.
Er ließ die Finger über den Griff seines Schwertes gleiten und lauschte. Das monotone klack-klack, klack-klack der Räder auf den Schienen wurde bald zu einer unheilvollen Melodie, die sich wie ein alter, vergessener Fluch in sein Gehör schlich.
Durch endlose Landschaften
Der Zug fuhr vorbei an schneebedeckten Feldern, so weit und leer, dass man das Gefühl bekam, die Welt bestehe nur noch aus Weiß. Dann wieder kroch der Zug durch Wälder, in denen die Bäume wie uralte Wächter standen, reglos, als hielten sie den Atem an, während er vorbeifuhr. Bei Dämmerung glichen ihre verzweigten Äste knochigen Händen, die sich gierig nach dem Zug reckten. Manchmal schwor Valerius, in der Tiefe zwischen den Stämmen glühende Augen gesehen zu haben – klein, gelb und lauernd.
Im Speisewagen, in dem er einmal kurz Rast machte, herrschte eine bedrückende Stimmung. Zwei Männer in schweren Mänteln spielten Karten, ohne ein Wort zu wechseln. Die Bedienung, eine junge Frau mit blassem Gesicht und eingefallenen Wangen, schenkte ihm Kaffee ein, der so schwarz war, dass er fast spiegelte.
„Sie fahren in die Karpaten?“ fragte sie leise, als hätte sie Angst, dass die Wände zuhören könnten. Valerius nickte nur. „Passen Sie dort auf“, fügte sie hinzu, und in ihren Augen blitzte für einen Moment echter Schrecken auf. „Die Berge… nehmen, was sie wollen.“
Er erwiderte nichts, aber der Satz blieb in ihm hängen wie ein Splitter.
Ankunft am Fuße der Karpaten
Als der Zug endlich in dem kleinen Bahnhof am Rand der Karpaten hielt, war es später Nachmittag. Die Sonne hing wie ein fahlgelber Fleck hinter einer dichten Wolkenschicht. Schon beim Aussteigen kroch ihm ein eisiger Hauch unter den Mantel – kein gewöhnlicher Wind, sondern etwas Schweres, das wie eine Hand auf seiner Brust lag.
Die Stadt war klein, fast ein Relikt. Häuser aus groben Steinen, deren Dächer tief unter Schnee lagen. Ihre Fenster wirkten wie schwarze Augenhöhlen, die Neuankömmlinge prüfend musterten. Auf den Straßen waren nur wenige Menschen zu sehen. Diejenigen, die ihm begegneten, senkten den Blick oder musterten ihn misstrauisch – und bewegten sich schnell weiter, als wollten sie den Schatten nicht zu lange ausgesetzt sein.
Kinder spielten nicht draußen. Hunde bellten nicht. Es war, als lauschte die Stadt selbst auf etwas, das tief in den Wäldern lauerte.
Das Gasthaus
Er fand Unterkunft in einem Gasthaus nahe des Marktplatzes. Das Gebäude war niedrig, aber langgezogen, mit dunklen Holzbalken, die wie Skelette den Flur stützten. Der Wirt stand hinter einer Theke, als Valerius eintrat. Er war ein hagerer Mann mit tiefen Furchen im Gesicht, und seine Augen hatten den Blick eines Menschen, der zu viel gesehen hatte.
„Ihr seid auf der Suche nach etwas, junger Mann.“ Seine Stimme war kaum mehr als ein Hauch, trocken wie altes Pergament.
Valerius stellte seine Tasche ab und musterte ihn. „Ich suche nur ein Bett für die Nacht.“
Der Wirt lächelte dünn. „Hier findet man selten nur das, wonach man sucht.“ Er lehnte sich ein Stück vor, sodass Valerius den Geruch von Tabak und kaltem Metall in seinem Atem wahrnahm. „Diese Berge… verbergen mehr, als das Auge sieht. Und sie… hören zu.“
Ein kurzer Moment des Schweigens, in dem nur das Knacken des Kaminfeuers zu hören war.
„Ich bin nicht hier, um Geschichten zu hören“, erwiderte Valerius kühl, doch in ihm wuchs das Gefühl, dass der Alte mehr wusste, als er sagte.
Der Wirt musterte ihn weiter, dann nickte er knapp, als hätte er eine unsichtbare Entscheidung getroffen. „Zimmer drei. Zweiter Flur links. Haltet nachts die Fenster geschlossen.“
Die Nacht legt sich über die Stadt
Als die Sonne hinter den gezackten Silhouetten der Berge verschwand, verriegelten die Bewohner ihre Türen mit schweren Eisenriegeln. Aus den Fenstern drang nur schwacher Kerzenschein. Die Straßen lagen im Dunkeln, und der Wind trug ein leises, unregelmäßiges Klopfen mit sich – als würde jemand mit den Fingerspitzen an hölzerne Wände tippen.
Valerius saß in seinem kleinen Zimmer, die Tasche in Reichweite, das Schwert griffbereit. Durch das geschlossene Fenster hörte er in der Ferne das Kratzen von etwas, das nicht wie ein Tier klang. Ein Wispern mischte sich darunter – so leise, dass er nicht sagen konnte, ob es von draußen oder aus den Wänden kam.
Er löschte das Licht und lauschte. Im Dunkeln kroch die Kälte näher, ein spürbares Gewicht in der Luft. Er wusste: Dies war nicht nur der Beginn seiner Suche. Dies war der Augenblick, in dem die Berge ihn bemerkt hatten.
Kapitel 3: Das vergessene Kloster
Der Weg zum vergessenen Kloster war mehr als ein Marsch durch Schnee – es war ein stilles Duell zwischen Mensch und Natur, das Valerius mit jedem Atemzug spürte. Die Wolken über ihm hingen schwer und tief, ein einziges, graues Grabtuch, das den Himmel zu verschlingen schien. Die Baumspitzen reckten sich wie schwarze Klauen, scharf gegen das fahle Licht. Unter seinen Stiefeln gab der Schnee ein feuchtes, schmatzendes Geräusch von sich, während seine Beine gegen den kniehohen Widerstand kämpften. Der Frost biss in seine Wangen, und der Wind schien gezielt die Lücken im Kragen seines Mantels zu suchen, um sich eiskalt auf seiner Haut festzukrallen.
Manchmal knickte ein Ast im Wind – ein dumpfer, brüchiger Laut, der in der Stille so laut wirkte, als hätte jemand hinter ihm einen Schritt gemacht. Mehr als einmal drehte er sich um, nur um nichts zu sehen… nichts, außer endlosen Baumreihen, deren Äste sich kaum merklich bewegten, als flüsterten sie miteinander.
Die Lichtung
Nach Stunden – oder vielleicht nur Minuten, Zeit war hier ein trügerischer Begleiter – löste sich der Wald auf. Der Nebel, der sich wie kalte Watte an seine Haut legte, gab den Blick frei auf etwas, das wie aus einer anderen Welt wirkte: das Kloster.
Das Gemäuer stand da wie ein gestrandeter Kadaver, halb verschlungen von Schnee, halb umklammert von wucherndem Efeu. Der Putz war von den Mauern gebröckelt, und das Dach klaffte an mehreren Stellen auf, sodass die Balken wie freigelegte Knochen in den Himmel ragten. Die Fenster glichen schwarzen Augenhöhlen, tief und leer, und Valerius konnte schwören, dass etwas in ihnen zurückstarrte.
Ein Hauch von Metall hing in der Luft – nicht der frische Geruch neuer Schmiede, sondern der dumpfe, süßliche Gestank von altem Blut. Es vermischte sich mit Moder, verrottetem Holz und einem Hauch von Asche. Alles an diesem Ort roch nach etwas, das man nicht berühren wollte.
Der Hof
Er stapfte durch den knirschenden Schnee und betrat den Hof. In der Mitte stand eine verwitterte Wetterfahne. Ihr Eisen knirschte im Wind wie ein rostiges Gebiss. Über dem Tor, das ins Innere führte, war in halb verblassten Lettern zu lesen: Lux in Tenebris.
„Licht in der Dunkelheit…“ murmelte Valerius. Er verzog den Mund zu einem bitteren Lächeln. „Hier ist nichts als Dunkelheit.“
Die schweren Holztüren des Eingangs gaben nur widerwillig nach. Ihr Schrei aus rostigen Scharnieren hallte unnatürlich laut zwischen den Mauern wider – als hätte der Ort selbst aufgeschreckt reagiert.
Im Inneren
Die Stille drinnen war nicht einfach das Fehlen von Geräusch – es war eine Stille, die lauschte. Das Mobiliar war verfault, Tische und Stühle zu zerfaserndem Holz zerfallen, überzogen mit grauem Schimmel. Schwarze Wasserflecken krochen wie Landkarten an den Wänden entlang, und aus den Schatten sickerten dünne Fäden von Kälte.
Dann das Geräusch – ein leises Knacken, wie ein Fuß auf morschem Holz. Valerius zog den Griff seines Schwertes fester. „Zeig dich“, flüsterte er.
Keine Antwort. Nur das langsame Tropfen von Wasser irgendwo in der Ferne… und wieder das Knacken. Diesmal begleitet von einem kaum hörbaren Kratzen, als würde eine Hand über Stein streichen.
„Ich habe keine Geduld für Spielchen“, knurrte er in den Gang hinein.
Der erste Dialog
Eine Stimme antwortete – rau, brüchig, irgendwo zwischen Husten und Flüstern. „Die Geduld… ist nicht dein Freund hier.“
Valerius drehte sich ruckartig um. Eine Gestalt stand im Schatten eines Torbogens, verborgen bis auf ein blasses, faltiges Gesicht, in dem zwei wässrige Augen funkelten.
„Wer bist du?“ fragte Valerius.
„Ein Wächter… vielleicht. Ein Narr… wahrscheinlich.“ Ein rasselndes Lachen folgte. „Du bist zu früh… oder zu spät. Je nachdem, wen du fragst.“
„Ich frage dich“, entgegnete Valerius, das Schwert ein Stück hebend.
Der Alte schüttelte den Kopf. „Mich fragt man nicht. Mich hört man nur. Und ich sage dir…“ Er trat ins Licht, und Valerius sah tiefe, violette Schatten unter seinen Augen. „Man hört hier Dinge. Dinge, die dich finden, wenn du nicht aufpasst.“
Die Treppe
Ohne ein weiteres Wort glitt der Alte zurück in den Schatten, bis er ganz verschwand. Valerius ging weiter. Sein Blick fiel auf eine Treppe, die nach oben führte. Das Holz war von der Feuchtigkeit aufgesogen, jeder Schritt ließ es knarren wie einen schmerzhaften Atemzug.
Oben roch die Luft anders – dichter, schwerer. An den Wänden hingen Wandmalereien: Szenen von Mönchen mit gesenkten Köpfen, Gesichtern, die in goldenen Heiligenscheinen leuchteten… und doch schien etwas an ihnen falsch, verschoben. Manche Augen waren zu rot, die Schatten zu tief, die Münder zu breit.
Der Korridor und die Silhouette
Ein Flüstern begann – erst wie das Rauschen des Windes, dann deutlicher, Stimmen, übereinandergelegt, zu schnell gesprochen, um zu verstehen. Sie schienen aus den Wänden selbst zu sickern, unter der Tapete zu pulsieren.
Am Ende des Ganges öffnete sich eine Tür. Kein Knarren, kein Dröhnen – sie stand einfach offen, als hätte jemand sie lautlos aufgestoßen. In dem dunklen Rahmen zeichnete sich eine Silhouette ab: groß, schmal, unbewegt. Die Schatten im Raum hinter ihr schienen sich zu verdichten, als lebten sie.
„Ich habe dich erwartet“, krächzte eine Stimme aus der Dunkelheit.
Valerius’ Griff um den Schwertknauf wurde fester. „Dann weißt du, dass ich nicht zum Plaudern hier bin.“
Ein leises, kehliges Lachen antwortete. „Oh… ich weiß viel mehr als das.“
Die Fackel in Valerius’ Hand zuckte, als ein unsichtbarer Windstoß sie fast auslöschte. Der Schatten vor ihm blieb still, aber die Luft vibrierte mit etwas, das wie lauernde Absicht wirkte.
Kapitel 4: Die Flüsternden Krypten
Das Innere des Klosters war kein Ort, an dem Menschen sein sollten. Es war kein Bauwerk mehr – es war ein verdorbener, atmender Organismus aus Stein, Staub und ungesagten Schreien. Jeder Gang wirkte wie ein schmaler Darm, der ihn tiefer und tiefer verschluckte. Die Wände atmeten Kälte, und in den Schatten lagen Dinge, die weder ganz lebendig noch ganz tot wirkten.
Valerius’ Taschenlampe zuckte unruhig, als würde ihr Licht spüren, dass es hier nicht willkommen war. Ein fahler Lichtkegel glitt über geborstene Steinplatten und enthüllte Risse, in denen ein schwärzlicher, feuchter Schimmel wuchs. Der Geruch war ein würgender Cocktail aus Moder, Asche und etwas Süßlichem, das den Magen umdrehte – der Geruch von altem Blut, das längst nicht mehr fließen sollte.
Unter seinen Stiefeln knackte es. Als er den Fuß hob, sah er, dass er auf einem halb zerfallenen Stück Kieferknochen getreten war. Der Splitter lag wie eine vergessene Drohung auf dem Boden.
Das erste Flüstern
„Geh… zurück…“ Es war kein lautes Geräusch. Es war kaum mehr als der Hauch einer Silbe, doch es schoss ihm wie eine Nadel ins Ohr. Er wirbelte herum. Nur schwankende Schatten. Kein Atem, kein Körper.
„Zeigt euch!“, rief Valerius in die Dunkelheit, und seine Stimme klang seltsam hohl, verschluckt von den Mauern. Eine Sekunde lang schwor er, ein Lachen gehört zu haben – tief unten, wie in einem Brunnen.
Die Treppe in die Tiefe
Er fand sie an einer schiefen Ecke: eine Steintreppe, deren Stufen von jahrhundertelangem Tropfwasser ausgehöhlt waren. Die Kanten waren glatt wie Knochen, die zu lange im Fluss gelegen hatten. Valerius zögerte nur den Bruchteil einer Sekunde. Die Luft hier unten war feuchter, dichter, fast träge, als würde sie widerwillig Platz für seinen Atem machen.
Mit jedem Schritt klang der Raum enger. Tropf… tropf… tropf – irgendwo rann Wasser, jeder Laut zog sich wie eine Metallkralle durch seine Nerven.
Nach wenigen Stufen wurde es so dunkel, dass selbst der Lichtstrahl seiner Lampe nicht mehr weit reichte – er fraß nur einzelne Bruchstücke aus der Finsternis, nie mehr.
Die Krypten erwachen
Unten angekommen, lag vor ihm ein langer, niedriger Korridor. Sarkophage standen an den Wänden, manche halb zerfallen, Deckel verrutscht, als hätte sich etwas von innen heraus gedrückt. Zwischen den Steinplatten lag ein feiner Schleier aus Staub, doch er war… gestört. Kleine Schleifspuren führten von einem Sarkophag in die Tiefe. Als hätte etwas Kriechendes hier gearbeitet.
Er spannte die Kiefermuskeln an. „Nur die Ratten… nur Ratten“, murmelte er – doch er glaubte es selbst nicht.
Die Begegnung
Hinter einem der größeren Sarkophage bemerkte er eine schmale Tür aus Eisen, beinahe vollständig von Steinen verschüttet. Er räumte sie beiseite, und das Metall quietschte protestierend, als er die Tür aufstieß. Ein Hauch kalter, uralter Luft strömte heraus – der Geruch alter Kerzen und… verbrannter Haare.
„Willkommen…“ Die Stimme kam aus dem Inneren. Tief. Weiblich. Er hob die Klinge seines Schwertes, trat vor.
„Zeig dich“, verlangte er.
„Du bist mutig… oder töricht.“ Die Stimme schien zu tanzen – mal von vorne, mal von der Seite, mal hinter ihm. „Ich bin nicht hier, um dir zu schaden… noch nicht.“
Der Raum des Amuletts
Die Kammer, die sich öffnete, war kreisrund. Im Zentrum: ein steinerner Sockel, darauf das Herz der Schatten. Es war kleiner, als er erwartet hatte – und ungleich bedrohlicher. Schwarze Edelsteine, die nicht nur das Licht reflektierten, sondern zu schlucken schienen. Bei jedem Atemzug hatte er den Eindruck, dass sich die Steine leicht verformten – als wären sie Augen, die blinzelten.
„Du willst es nehmen.“ Die Stimme war wieder da, jetzt sanft wie warmer Atem im Nacken. Er drehte sich – niemand.
„Ich bin hier, um etwas zu beenden“, antwortete er fest. Ein leises Lachen wehte durch den Raum. „Oder um es zu beginnen.“
Das Flüstern wächst
Als seine Finger das Amulett berührten, zuckte eine Kälte durch seinen Arm, so brutal und scharf, dass er kurz die Luft einsog. Die Dunkelheit um ihn begann zu wogen. Aus ihr lösten sich Silhouetten – lange, verwaschene Gestalten, deren Gesichter in einem Strudel aus Schatten verloren waren. Das Flüstern explodierte. Keine einzelnen Worte mehr – nur eine Kakophonie aus uralten Silben.
Er presste das Amulett an sich. „Was wollt ihr?!“ Ein Chor von Stimmen antwortete, synchron, unnatürlich: „Dich.“
Der Moment vor dem Bruch
Die Schatten rückten näher, tasteten nach ihm. Der Boden unter seinen Füßen vibrierte, als würde tief darunter etwas Großes atmen. Er wusste – er war nur einen Schritt von etwas entfernt, das ihn unwiderruflich verändern würde.
Er blickte auf das Herz der Schatten, dann auf die Schwärze um ihn. „Dann soll es so sein.“
Und in diesem Augenblick, bevor sich die Dunkelheit schloss, lächelte etwas im Schatten.
Kapitel 5: Die Falle schnappt zu
Das Flüstern war nicht mehr nur ein Geräusch – es war eine Substanz, ein kalter Nebel, der Valerius’ Schädel füllte und gegen seine Gedanken drückte. Mit jeder Sekunde wurden die Laute klarer, wachsamer, als würden sie ihn umkreisen. Aus dem unverständlichen Säuseln formten sich Silben, die er nicht kannte und doch zu spüren glaubte. Jede einzelne fraß sich wie ein Haken in sein Bewusstsein.
„Fall-e… Fall-e…“
Das Wort zerschnitt die Stille in seinem Kopf wie eine Rasierklinge aus Eis.
Sein Atem ging schneller, Wolken bildeten sich vor seinem Gesicht. Die Härchen an seinen Armen stellten sich auf, als würden unsichtbare Finger sanft darüberstreichen – nur um sich dann in ein krampfhaftes Festhalten zu verwandeln.
Das Zuschlagen der Tür
Das Krachen kam ohne Vorwarnung. Ein dumpfer, gewaltiger Schlag, als wäre ein riesiger Rammbock gegen die schwere Steintür geprallt. Staub regnete von der Decke, winzige Splitter fielen in seinen Nacken. Noch bevor er reagieren konnte, hörte er den Klang sich verändernder Mechanismen – ein uraltes Schloss, das mit einem metallischen Klacken in die Endposition glitt.
Die Tür war zu. Und nicht nur zu – sie wollte nicht mehr aufgehen.
Das Pulsieren des Amuletts in seiner Faust war der einzige Lichtschein, ein kränkliches Glimmen, das mehr Schatten schuf, als es vertrieb.
Die ersten Schatten
Sie kamen lautlos. Zuerst nur Bewegungen am Rand seines Blickfelds, dann Gestalten, die sich aus der Schwärze lösten – zu hoch für Menschen, zu verzerrt für Tiere. Ghule.
Ihre Haut spannte sich so dünn über die Knochen, dass er jede Kerbe und jeden Splitter sah. Die langen Arme endeten in Klauen, die im matten Licht feucht glänzten. Ihre Augen waren glühende Punkte, rot wie frisch geöffnetes Fleisch.
Einer der Ghule sprach. Seine Stimme war wie ein Raspeln auf Metall: „Das Herz… gib uns… das Herz.“
Valerius spannte die Kiefermuskeln an. „Kommt und holt es euch.“
Der Kampf
Die ersten beiden sprangen gleichzeitig – lautlos, bis auf das sirrende Geräusch ihrer Krallen. Er riss das Schwert hoch, die Silberklinge zischte durch die Luft und trennte dem ersten Angreifer fast den halben Schädel. Schwarzes Blut spritzte, dampfte, als es den kalten Stein berührte.
„Zurück!“, fauchte er.
Der zweite Ghoul wich nicht zurück. Er duckte sich unter einem Hieb hindurch, schoss mit unnatürlicher Geschwindigkeit an Valerius’ Flanke und riss mit den Klauen an seinem Mantel. Der Stoff platzte auf, doch die Haut darunter blieb unversehrt.
„Gesegneter Stahl“, zischte eine Stimme irgendwo in der Schwärze. „Er weiß, wie man tötet.“
Das Amulett reagiert
Das Herz der Schatten glühte nun stärker. Jeder Herzschlag des Artefakts sendete eine Welle aus – nicht Licht, nicht Wärme, eher eine pulsierende Kraft, die die Ghule zurücktaumeln ließ… nur um sie im nächsten Augenblick wieder anzulocken.
„Ihr könnt es nicht haben“, knurrte Valerius, „solange ich atme.“ „Dann atme nicht“, flüsterte eine Stimme ganz nah an seinem Ohr, obwohl dort niemand stand.
Er wirbelte herum, Klinge erhoben – und sah sie.
Rumanjas Ankunft
Zuerst nur Umrisse. Dann wurde die Silhouette dichter, als würde sie aus der Dunkelheit selbst geknetet. Rumanja trat ins fahle Licht, und mit jedem Schritt schien der Raum kleiner zu werden.
Ihre Augen glühten wie Kohlen in einem kalten Ofen. Das lange, schwarze Haar schwebte, als stünde sie unter Wasser. Ein Duft aus süßem Verfall und scharfem Schwefel legte sich wie ein unsichtbarer Mantel über ihn.
„Valerius von Falkenberg…“ Ihr Ton war weder freundlich noch hasserfüllt – er war endgültig. „Du trägst es. Ich kann es fühlen. Es gehört mir.“
„Dir gehört gar nichts mehr“, presste er zwischen den Zähnen hervor. „Alles hier… gehört mir“, antwortete sie, und ihre Stimme schwoll an wie ein Sturm.
Das Erstarren der Welt
Die Ghule zogen sich zurück, als hätte jemand einen unsichtbaren Befehl gegeben. Die Dunkelheit wurde dichter, doch kein Laut drang mehr herein. Selbst der Tropfen von Wasser, den er zuvor gehört hatte, verstummte.
Nur ihr Blick hielt ihn gefangen. Er fühlte, wie das Amulett in seiner Hand brannte, die Hitze schoss in seinen Arm, als wollte es sein Blut austauschen gegen etwas Fremdes.
„Gib es mir, Valerius. Freiwillig – und ich schenke dir den Traum vom Leben.“ „Ich träume nicht“, sagte er kalt. „Dann wirst du lernen“, hauchte sie, und als sie die Hand hob, verzogen sich die Schatten hinter ihr zu einem einzigen, massiven Mahlstrom.
Die Entscheidung
Er wusste, dass er in diesem Raum keine Zeit mehr haben würde – weder zum Denken noch zum Zögern. Die Falle war perfekt. Die Tür hinter ihm, die Kreaturen vor ihm, und in der Mitte sie – ein Knoten aus Macht und Bosheit.
Er spürte, wie sein Herzschlag den Rhythmus des Amuletts annahm. Ein Teil von ihm wollte es ihr geben, einfach nur um den Druck, den Sog, diesen Albtraum zu beenden. Ein anderer Teil wusste, dass er damit alles verloren hätte – nicht nur sich selbst.
„Komm und hol’s dir“, sagte er schließlich.
Rumanjas Lächeln war langsam und grausam. „Wie du wünschst.“
Kapitel 6: Die Begegnung im Schatten
Die Krypta war so still, dass Valerius den eigenen Puls in den Ohren dröhnen hörte. Der Geruch aus Moder, kaltem Stein und altem Blut hing wie eine unsichtbare, träge Suppe in der Luft – jeder Atemzug schmeckte nach Verfall. Er wusste, dass er nicht allein war. Er fühlte es. Die Dunkelheit war kein leerer Raum. Sie beobachtete. Sie atmete. Sie wartete.
Dann – ein kaum wahrnehmbares Glimmen in der Tiefe. Etwas begann sich zu lösen, als hätte sich ein Schatten entschlossen, eine Form anzunehmen. Sanftes, seidiges Rascheln, wie das Streifen feiner Stoffe in völliger Stille. Und aus den tiefsten Falten der Schwärze trat sie hervor.
Ihr Auftauchen
Rumanja Katadka. Eine Erscheinung von unnatürlicher Schönheit und abgrundtiefer Verderbtheit. Das lange Gewand aus schwarzer Seide floss wie ein dunkler Strom über den Boden, ohne ihn zu berühren. Bei jeder Bewegung schien der Stoff ein Eigenleben zu führen, mit einem Schimmer, der mehr an flüssigen Rauch erinnerte als an Textil. Ihre Augen – rot wie verglühende Glut in einem toten Kamin – schnitten durch den Raum, fixierten ihn mit einer Kälte, die nicht von dieser Welt war.
Die Luft um sie herum war plötzlich kälter. Nicht wie die Kälte des Winters – es war ein tiefer, körperloser Frost, der in sein Inneres kroch, als würde er von innen heraus gefrieren. Sein Atem war nur noch ein dünner Dampf in der dichten Finsternis.
Das erste Wort
„Der Sohn der Jägerin.“ Die Stimme war leise, aber jeder Laut saß wie ein Dolchstoß. Nicht laut, und doch so klar, als hätte sie ihn direkt in seinen Kopf geflüstert. Es klang wie das Rascheln trockener Blätter – und darunter diese hypnotische Melodie, die ihm das Gefühl gab, dass seine Knie sich von selbst beugen wollten.
Er antwortete nicht sofort. Jede Reaktion fühlte sich an, als könnte sie ein Tor öffnen, das besser verschlossen bliebe.
„Du hast das Erbe deiner Mutter angetreten… nicht wahr?“ Ein kaum wahrnehmbares Lächeln, das nicht ihre Augen erreichte. „Ein Fehler… mein Junge.“
Valerius spürte, wie die Worte an seinem Selbstbewusstsein nagten – schleichend, mit der Geduld einer Schlange, die wartet, bis der Widerstand erlahmt.
Die Diener im Schatten
Die Ghule, die eben noch an den Rändern der Finsternis lauerten, krochen zurück. Ihre ledrige Haut spannte sich knisternd über gebogene Knochen, und das schwache Licht ließ Narben erahnen, die älter waren als das Gedächtnis der meisten Menschen. Sie zitterten vor ihr – nicht vor Valerius. Die Furcht, die sie ausstrahlte, wirkte wie ein stiller Befehl.
Das Amulett im Fokus
Rumanjas Blick fiel auf das Amulett in seiner Hand. „Du hast es gefunden“, hauchte sie, fast ehrfürchtig. „Ein wertvolles… Spielzeug.“ Ihre Lippen verzogen sich zu einem dünnen Lächeln. „Aber es ist nicht deins.“
Sie hob eine Hand. Die Fingernägel, lang und scharf, glänzten im matten Schimmer des Amuletts – wie schwarzes Glas, das in Flammen gehärtet wurde. „Gib es mir. Und du gehst hier hinaus. Aufrecht.“
Worte wie Fallen
„Und wenn nicht?“ Er merkte selbst, wie rau seine Stimme klang.
„Dann…“ Sie neigte leicht den Kopf. „…wirst du sehen, wie viele Stücke ein Herz haben kann, bevor es aufhört zu schlagen.“
Valerius zwang sich, den Griff um sein Schwert nicht zu fest anzuziehen – er wollte nicht zeigen, wie sehr seine Hände zitterten. „Ich bin nicht hier, um zu verhandeln.“
Rumanja lachte. Es war kein Lachen aus Humor – es war ein Klang, der an das Brechen dünner Eisschollen erinnerte. „Niemand verhandelt mit der Dunkelheit. Man erkennt sie… oder sie frisst dich.“
Das Nahen
Sie trat einen Schritt näher. Die Schatten um sie herum bewegten sich mit, als wären sie an unsichtbaren Fäden befestigt. Valerius hatte das Gefühl, dass der Raum schrumpfte. Die Kristalle in den Wänden begannen zu knistern, feine, funkelnde Risse liefen über ihre Flächen, als wollten sie die aufgeladene Energie entladen.
„Du weißt nicht, was du in dir trägst“, flüsterte sie, und diesmal lag etwas Unheimlich-Liebevolles in ihrer Stimme, das ihn noch mehr erschreckte als Drohungen. „Aber ich weiß es.“
„Sag’s mir“, forderte er, die Stimme nun fester. „Nein“, hauchte sie, „ich werde es dir zeigen.“
Der Moment vor dem Sturm
Die Dunkelheit um sie begann zu pulsieren – synchron zum Schlagen des Amuletts. Etwas regte sich darin, nicht sichtbar, aber fühlbar. Valerius spürte, wie die Kälte in seine Knochen kroch, wie das Flüstern in seinem Schädel zu einem dumpfen Dröhnen anschwoll.
Er hob das Schwert. Sein Blick war fest – nicht furchtlos, aber entschlossen.
Rumanja neigte leicht den Kopf, als würde sie ein interessantes Spielzeug betrachten. „Dann tanzen wir, Jäger.“
Die Schatten zogen sich nicht zurück. Sie kamen näher.
Und das Flüstern schlug in Schreie um.
Kapitel 7: Der Tanz des Todes
Der erste Schlag kam ohne Vorwarnung. Nicht als Bewegung, sondern als Gefühl. Ein plötzlicher Druck, der sich wie eine eiserne Faust auf Valerius’ Brust legte. Noch bevor er reagieren konnte, löste sich Rumanja aus der Schwärze – kein Körper, keine Gestalt, nur eine fließende Bewegung wie kalter Rauch, der plötzlich eine Form fand.
Ihre Augen waren wie zwei winzige Sonnen aus Blut. Jeder Blick ein Stich, jeder Schritt ein lautloser Hieb in seine Entschlossenheit.
Die Krypta als Gegner
Die Krypta war nicht einfach nur Schauplatz. Sie atmete mit ihnen. Das tropfende Wasser von irgendwo tief in den Gängen klang jetzt wie ein Schlag auf Metall. Winzige Partikel von Staub und Schimmel trieben im schwachen Licht des Amuletts wie Insekten in einem morschen, goldenen Glas. Das Amulett selbst pulsierte unruhig, als würde es die Gefahr genauso spüren wie er.
Die Schatten an den Wänden bewegten sich nicht mehr im Rhythmus seines Lichtes – sie bewegten sich unabhängig, gegen den Takt, als wären sie Teil ihres Willens.
Der erste Austausch
„Du bist langsamer, als ich gehofft hatte,“ spottete Rumanja, während sie fast mühelos einem Schwertschlag auswich. Ihre Stimme klang spöttisch und musikalisch zugleich, wie das Summen einer Saite, kurz bevor sie reißt.
„Und du…“ Valerius parierte einen blitzschnellen Ausfallschritt, das Metall seines Schwertes kreischte gegen ihre Krallen. „…bist genau so hässlich, wie ich es mir vorgestellt habe.“
Sie lachte. Es war ein Lachen ohne Freude, ohne Wärme – ein Laut, der sich in den Schädel fraß. „Dich am Leben zu lassen, war ein Fehler deiner Mutter.“
Der Name seiner Mutter war ein Schlag ins Gesicht. Ein Lufthauch von Zorn stieg in ihm auf. Er wich zurück, den Blick fest auf sie geheftet.
Die Tänzerin im Dunkel
Rumanja bewegte sich wie ein Tanz aus Nebel und Stahl. Sie trat nie dorthin, wo er sie erwartete. Jedes Mal, wenn er zustieß, war sie bereits verschwunden, nur um an einer anderen Stelle des Raumes wie aus dem Nichts wieder aufzutauchen.
„Weißt du, was mich an Jägern wie dir amüsiert?“ Ihre Stimme schlich sich von allen Seiten an ihn. „Ihr kommt mit euren Klingen, euren Kreuzen, eurem heiligen Wasser… und glaubt, ihr kämpft gegen Monster.“
Sie tauchte direkt vor ihm auf, ihre Finger mit den schwarzen, metallisch glänzenden Nägeln nur Zentimeter von seiner Kehle entfernt. „Aber die Wahrheit, Valerius… ist, dass ihr es seid, die Angst machen.“
Er schlug ihre Hand beiseite und wirbelte herum, sein Schwert beschrieb einen silbernen Halbkreis. „Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen.“
Der Druck der Enge
Der Raum schien zu schrumpfen. Die Krypta knirschte und ächzte, als ob die Mauern selbst näher rücken wollten. Das schwache Leuchten des Amuletts wurde von der Dunkelheit verschluckt wie von einem lebendigen Tier.
Valerius zog das Weihwasser, warf es in einem weiten Bogen. Die Tropfen funkelten kurz in der Luft – und verdampften, bevor sie auftrafen.
„Schön, dass du’s versucht hast,“ flüsterte Rumanja, während sie an ihm vorbeiglitt und ihr Kleid im Vorübergehen kalt wie Eis an seiner Hand streifte. „Aber deine Zeit läuft ab.“
Das Anziehen der Schlinge
Sie ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Jeder Schritt, jeder Atemzug war von ihrem Schatten begleitet. Er hörte ihren Atem nicht – aber er fühlte ihn, als wär er in seinem Kopf.
„Sag mir, Valerius…“, ihre Stimme war nun leiser, gefährlicher, „…wenn ich dir jetzt das Herz herausreiße, willst du, dass es schnell geht, oder soll es wehtun?“
„Probiere es aus,“ stieß er hervor und machte einen Schritt nach vorne. „Vielleicht gefällt dir die Antwort nicht.“
Das Duell der Blicke
Für einen Moment standen sie still. Nur ihre Blicke rangen miteinander – sein aus sturer Entschlossenheit, ihrer aus bodenloser Gewissheit. Es war, als hielte die ganze Krypta den Atem an.
Dann – Explosion von Bewegung. Klinge gegen Krallen, Funken aus Metall und uralter Magie. Jeder Schlag hallte von den Wänden wider wie ein Donnerschlag in einem engen Tal.
Der Bruchmoment
Ein unachtsamer Schritt ließ Valerius gegen eine der steinernen Säulen stoßen. Staub rieselte auf ihn herab. Rumanja nutzte den Augenblick – ihre Hand schnellte vor, packte ihn am Kragen und riss ihn hoch.
„Fühlst du es?“ Der Druck in ihrer Stimme war ebenso spürbar wie der Druck ihrer Finger an seinem Hals. „Das ist die Nacht. Sie gehört mir.“
Mit letzter Kraft stieß er ihr das Schwert zwischen sie beide – keine tiefe Wunde, aber genug, dass sie ihn losließ und zurückwich. Dunkle Flüssigkeit tropfte von der Schneide, zischte, als sie den Boden berührte.
„Ich gehöre niemandem,“ keuchte Valerius.
Kein Ende in Sicht
Ihr Lächeln war gefährlich breit. „Das werden wir sehen.“
Der Tanz ging weiter, schneller, brutaler. Jeder Schritt wirbelte Staub und Schatten auf, jeder Treffer ließ die Krypta stöhnen. Und irgendwo, ganz tief, hörte Valerius das Pochen des Amuletts – nicht mehr in seiner Hand, sondern in seinem Herzen.
Der Tanz des Todes hatte begonnen – und das Ende war noch nicht einmal in Sicht.
Kapitel 8: Eine unerwartete Flucht
Die Krypta bebte. Nicht nur unter dem Gewicht des Kampfes, sondern als würde etwas im uralten Mauerwerk selbst aufwachen. Steine mahlten leise gegeneinander, Staub rieselte von den Gewölben wie grauer, trockener Schnee. Jeder Schlag hallte zurück – doppelt, dreifach – als wollten die Wände jedes Geräusch verschlingen und dann in veränderter, drohender Form wieder ausstoßen.
Mitten in diesem Wirbel aus Bewegung und Schatten stürzte Valerius vor. Sein Herz pumpte nicht mehr in Schlägen – es hämmerte wie eine Trommel, getrieben von Angst und der fiebrigen Gewissheit, dass hier alles entschieden werden könnte.
Der Schlag
Er zielte auf ihre Brust, der Bogen seines Schlages so perfekt wie instinktiv. Doch statt Fleisch traf seine Klinge das Amulett in ihrer linken Hand – groß, düster, und voller einer greifbaren, uralten Macht.
Ein Laut, scharf wie splitterndes Glas, zerriss die Luft. Es war, als breche etwas, das nicht nur Materie, sondern auch Raum und Zeit in sich hielt.
Ein greller Lichtblitz brach aus dem Amulett hervor – nicht warm wie Sonne, sondern gleißend, als hätte jemand einen Stern durch ein Nadelöhr gezwungen. Der Strahl schnitt durch die Dunkelheit, ließ Konturen verschwimmen und brannte Valerius für einen Atemzug das Augenlicht aus.
Rumanjas Schrei
Rumanjas Aufschrei war kein menschlicher Laut. Er war ein uraltes Heulen, das Trauer, Zorn und etwas anderes – eine bodenlose, verletzte Eitelkeit – in sich trug. Die Ghule in den Schatten zogen sich knurrend zurück, manche hielten sich, als könnten sie das überhaupt, die Ohren zu.
„Was… hast… du… getan?“ Ihre Stimme war zerrissen, flackerte zwischen mehreren Tonlagen, als spräche nicht nur eine Kehle zu ihm, sondern ein Chor von Stimmen aus längst gestorbenen Mündern.
Valerius starrte auf das Amulett, nun nur noch eine geborstene Schale in ihren Händen. „Den Anfang vom Ende“, presste er heiser hervor.
Das Schwanken der Dunkelheit
Die Finsternis um sie flackerte – kurz nur, wie eine Kerze im Wind. Doch es reichte, damit ein dünner Strahl von Kälte durch die Krypta fegte, der selbst den Atem der Steine anzuhalten schien.
Die Schatten an den Wänden zogen sich zurück, verzerrten sich, wie Tiere, die den Geruch von Feuer wittern. Einen Herzschlag lang glaubte Valerius, sie könnten ihn jetzt freigeben – aber dann schloss sich das Dunkel wieder, dichter, schwerer, drohender.
Fluchtinstinkt
Er wusste, dass er den Moment nutzen musste. Seine Beine setzten sich in Bewegung, noch bevor sein Kopf den Entschluss vollständig gefasst hatte. Er stieß sich von der feuchten Wand ab, sprang an Rumanja vorbei, die noch immer taumelte, den Blick hasserfüllt, aber benommen.
„Du entkommst mir nicht!“ Ihr Aufschrei war ein Keulenschlag in seinen Rücken. „Vielleicht nicht für immer,“ keuchte er, ohne sich umzudrehen, „aber für heute.“
Der Weg zur Tür
Die Krypta zog sich wie ein Albtraum. Der Weg zum Steintor schien länger, der Boden zäher, als würden unsichtbare Hände nach seinen Stiefeln greifen. Über ihm tropfte Wasser von den Gewölben, in unregelmäßigen Abständen – wie ein grotesker Countdown, der ihm verriet, wie wenige Atemzüge ihm noch blieben.
Hinter ihm das Scharren ihrer Schritte. Nicht eilig. Bedrohlich. Wie ein Raubtier, das weiß, dass die Beute keine Chance mehr hat – und das den Moment auskostet.
Das Tor
Das Steintor stand vor ihm wie ein Koloss, dessen Gesicht im Halbdunkel verschwamm. Er stemmte sich dagegen, fühlte das kalte Gestein unter seinen Handflächen, roch den Moder, der aus den jahrhundertealten Fugen strömte. Ein dumpfes Grollen lief durch den Rahmen, als sich der alte Mechanismus löste.
Draußen: grelles Tageslicht. Es fiel wie ein Schwert durch die Öffnung, schnitt einen schmalen Riss in die Krypta.
Der Schnitt ins Licht
Er stolperte hinaus, geblendet, als hätte jemand ihm Feuer in die Augen gegossen. Die Kälte des verschneiten Waldes traf ihn wie ein Schlag. Hinter ihm das Kreischen Rumanjas – schrill, zornig, gebrochen. Es hallte noch in den Bäumen, selbst als er schon weit gerannt war.
Der Wald
Die Äste griffen nach ihm wie lange, schwarze Finger. Schnee brach unter seinen Stiefeln, wirbelte in kleinen Fontänen hoch. Sein Atem wurde zu weißen Schwaden, die sofort vom Wind zerrissen wurden.
Er wagte keinen Blick zurück. Er wusste, wenn er ihren Blick jetzt noch einmal sah, könnte er ins Straucheln geraten – und das wäre sein Tod.
Nachklang
Das Bild des Moments brannte sich ein: Rumanja, gebückt, das zerbrochene Amulett in den Händen. Ein Blick, der keine Gnade kannte.
Er spürte es: Sie würde ihn jagen. Nicht heute. Vielleicht nicht morgen. Aber bald. Und wenn sie kam, würde sie nicht allein sein.
Kapitel 9: Die Narbe der Jagd
Der Wald stand still, aber es war kein friedlicher Stillstand. Es war die Art von Stille, die knistert – als hielte die Natur den Atem an, weil sie weiß, dass etwas Furchtbares gleich geschehen wird.
Valerius stolperte durch das Unterholz, keuchend, das Herz wie ein Vorschlaghammer in seiner Brust. Seine Beine fühlten sich an wie feuchtes Leder, das jeden Augenblick reißen könnte, aber er zwang sie weiter. Über ihm hing der Himmel wie eine Wunde, aus der sich träge, blutrote Wolken über die Baumwipfel schoben. Der Wind griff in die Äste, ließ sie knarren, als würden knochige Hände gegeneinander reiben.
Das Brennen der Narbe
Er presste die Hand gegen den Unterarm. Das Blut war warm, fast schon zu warm – als hätte die Wunde ein Eigenleben. Dort, wo Rumanjas Krallen ihn erwischt hatten, pochte es im Rhythmus seines Herzschlags.
„Du läufst… aber wie lange, Valerius?“ Die Stimme war nicht da – nicht wirklich –, aber sie flackerte in seinem Kopf auf wie ein böses Flüstern.
Er biss die Zähne zusammen, stolperte über eine Baumwurzel. Ein kurzer Aufschrei, dann fing er sich wieder. Jeder Schatten zwischen den Bäumen schien ihr Gesicht zu formen – die spitzen Zähne, die Augen, die wie flüssiges Feuer leuchteten.
Der Weg in die Geisterstadt
Das Gelände wurde unwegsamer. Der Boden knirschte unter Splittern von Schiefer und altem Holz, morsches Laub klatschte nass gegen seine Stiefel. Der Nebel kam in Wellen, schob sich wie lebendige Schwaden zwischen die Stämme.
Schließlich tauchten die ersten Ruinen auf. Schiefe Häuser, ihre Dächer wie aufgebrochene Särge. Fensterhöhlen, in denen schwarze Leere lauerte. Türen, die im Wind schwankten, als wollten sie ihn hereinwinken.
Er wusste, wohin er musste. Ein Name war in seinem Kopf wie eine letzte Kerze in völliger Dunkelheit: Dr. Albrecht Korrin. Ein Mann, der angeblich nie wirklich lebte – oder nie ganz starb – und dessen Hände Wunden schließen konnten, die kein normaler Arzt berühren wollte.
Das Haus des Arztes
Die Tür war schwer, das Holz von Jahren aufgequollen. Sie ächzte auf, als Valerius hineinstolperte.
Drinnen roch es nach altem Papier, Moder… und einer seltsamen Note von Lavendel, die irgendwie fehl am Platz wirkte. Die Schatten in den Ecken waren träge, als würden sie ihn mustern.
„Schließ die Tür, Junge.“ Die Stimme kam aus einer dunklen Ecke. Langsam schälte sich der Arzt aus dem Schatten: ein schmaler Mann, graues, wirres Haar, der Rücken krumm wie ein alter Ast. Seine Augen waren schwarz und glänzten wie nasses Glas.
„Dr. Korrin…“ Valerius’ Stimme war kaum mehr als ein kratzendes Husten. „Ich brauche… Hilfe.“
Das Gespräch
Der Arzt trat näher, das Gesicht in ein unbehagliches Halblicht getaucht. „Ich weiß, wer dich geschickt hat.“ „Niemand hat—“ „Lüg mich nicht an. Rumanja lässt ihre Beute nicht ohne Grund laufen. Zeig her.“
Valerius streifte den Mantel ab, zog zögernd den Stoff von seiner Wunde. Korrin beugte sich vor. Der Blick in seinen Augen veränderte sich – von nüchterner Analyse zu etwas… anderem. Etwas, das fast wie Furcht aussah.
„Das ist… kein gewöhnlicher Schnitt.“ Seine Stimme klang rau, als müsste er die Worte durch ein enges Tor zwängen. „Sie hat dir mehr hinterlassen als Blutverlust.“ „Was meinen Sie?“ Korrin richtete sich auf, ging zu einem Schrank und holte eine kleine Flasche hervor, in der eine dunkle, träge Flüssigkeit schimmerte. „Das hier wird dein Blut reinigen. Vielleicht.“ Er sah Valerius fest an. „Aber die Narbe… wird bleiben. Sie ist ein Schlüssel. Zu was genau, will ich gar nicht wissen.“
Die Behandlung
Er tupfte das Elixier mit einem Lappen auf die klaffende Linie. Valerius’ ganzer Körper spannte sich – das Gefühl war, als würde flüssiges Feuer in seine Adern gegossen. Er schrie auf, und der Arzt packte ihn grob an der Schulter.
„Halt still. Oder ich schneid dir den Arm ab, und dann hast du ein ganz anderes Problem.“ Der Schmerz ebbte nach einigen Atemzügen ab. Stattdessen kam eine kühle Schwere, als hätte das Elixier einen Teil von ihm betäubt… oder fortgenommen.
Korrin wickelte ein altes, fleckiges Tuch um den Arm. „Du hattest Glück, Valerius. Aber das Glück ist launisch. Die Narbe ist jetzt ein Teil von dir. Und sie wird dich rufen.“
Die Warnung
Valerius hob den Blick. „Rufen?“ „Du wirst sehen. Manche Wunden heilen. Andere… flüstern dir im Schlaf zu. Und wenn du Pech hast, bringt sie zurück, was sie verursacht hat.“
Ein Windstoß ging durch die Ritzen des Hauses, ließ eine lose Tür in der Ferne schlagen. Korrin sah dorthin, sein Blick scharf wie ein Schnitt. „Du solltest nicht bleiben. Nicht hier. Nicht in dieser Stadt. Ich kann dich flicken, aber ich kann dich nicht retten.“
Valerius stand auf, der Arm schwer, der Kopf voller Fragen. Draußen im Nebel schien sich etwas zu bewegen – eine Silhouette, zu weit entfernt, um sie genau zu erkennen. Vielleicht nur ein Baum. Vielleicht nicht.
Nachhall
Er ging zur Tür, hielt inne und sah zurück. „Danke.“ Korrin lächelte nicht. „Bewahr dir den Dank. Du wirst ihn brauchen, wenn du merkst, dass die Jagd noch nicht vorbei ist.“
Draußen schloss der Nebel sich um ihn wie ein Vorhang. Die Narbe pulsierte, als wolle sie ihn führen. Wohin – das wusste er nicht. Aber tief in sich ahnte er: Der erste Akt war vorbei. Und der wahre Schrecken stand erst noch bevor.
Kapitel 10: Neue Spuren in Venedig
Das Hotelzimmer
Die Wände waren dünn wie Pergament, und in den Nächten hörte Valerius jede Bewegung des alten Hauses. Wasser tropfte stetig aus einem undichten Rohr im Flur, das Geräusch hallte wie ein ferner Herzschlag durch die muffigen Korridore. Der Geruch – eine Mischung aus Moder, abgestandenem Wasser und vergilbtem Papier – kroch ihm in die Lungen und haftete selbst an seiner Kleidung. Im schwachen Schein einer schief stehenden Tischlampe lagen die Notizen seiner Mutter ausgebreitet wie ein unvollendetes Puzzle.
Er beugte sich über das Papier, strich mit den Fingern über krakelige Linien, versteckte Symbole und Zeichnungen von merkwürdigen Kreisformationen, in deren Mitte immer wieder das Motiv eines Löwenkopfes auftauchte. Manche Seiten waren verschmiert, als hätte jemand Blut oder dunkle Tinte darüber verschüttet. Jede Stunde, die er damit verbrachte, verschluckte ihn tiefer in einen Strudel aus Fragen, während draußen das Wasser der Kanäle träge gegen die Mauern schlug.
Das Amulett
Das Amulett lag stets in seiner Reichweite, schwer wie eine Schuld, die man nicht ablegen kann. Er drehte es zwischen den Fingern, das kalte Metall saugte ihm förmlich die Wärme aus der Haut. Die Gravuren wirkten bei jedem Blick anders – manchmal wie Runen, dann wieder wie winzige, ineinander verkrampfte Gesichter, die im Schatten zu flüstern schienen.
Zwei-, dreimal hatte er sich schwören können, dass er bei langem Hinsehen ein leises Pochen hörte. Es reagierte nicht auf Licht, nicht auf Wärme. Nur auf etwas, das er nicht benennen konnte. Etwas in ihm.
Die Legende
Es war kurz nach Mitternacht, als sein Blick an einer Fußnote in einem brüchigen Band hängenblieb. Die „Bruderschaft des Löwen“. Die Worte prickelten in seinen Ohren, als würde jemand sie direkt hinein sprechen.
Sie wachten über die Grenzen zwischen Licht und Schatten.
Die Bruderschaft hatte, so hieß es, im 13. Jahrhundert hier in Venedig eine Handvoll Männer und Frauen vereint, die nicht nur gegen das menschliche Böse, sondern gegen ein älteres, blutdurstiges Dunkel kämpften. Ihr Ziel: die Ausbreitung des Vampirismus eindämmen, bevor er Europa verschlingen konnte.
Von einem besonderen Artefakt war die Rede – einem Amulett, das im richtigen Moment nicht nur Schwächen offenbaren, sondern auch die Vernichtung jener herbeiführen konnte, die von der Nacht verdammt waren.
Sein Atem beschleunigte sich. Er hielt inne, lauschte in die Stille des Zimmers – als fürchte er, jemand könne hören, woran er gerade dachte. Vielleicht war dieses Amulett in seiner Hand mehr als ein Erbstück. Vielleicht war es das einzige Mittel gegen Rumanja.
Aufbruch in die Nacht
Der Entschluss kam plötzlich. Er warf Notizen, Amulett und ein Taschenmesser in seine abgewetzte Ledertasche. Draußen lag Venedig im Nebel, als hätte jemand Watte in die Straßen gegossen. Die Laternen warfen schwache Kreise, in denen der Nebel tanzte. Von fern kam das leise Klatschen eines Ruders gegen Wasser.
Die Gassen wurden enger, die Fassaden feucht und fleckig vom Atem der Lagune. Kein Mensch begegnete ihm. Und doch hatte er das Gefühl, begleitet zu werden. Schatten huschten an den Rändern seines Blickfelds, verschwanden, wenn er den Kopf drehte.
Der Palazzo
Der Bau war ein kranker Zahn am Rand des Kanals: Fenster wie blinde Augen, Balkone, deren Eisenstäbe wie krumme Finger ins Nichts ragten. Die Tür – eine Platte aus schwarzem Holz, eingeschnürt mit Rissen – gab nach einem langen, klagenden Knarren nach.
Innen roch es nach fauligem Wasser, das Geräusch der Wellen schwappte gedämpft durch die Mauern. Ein dünner Kerzenschein glomm am anderen Ende des Raums, flackerte, als Valerius näherkam.
Begegnung mit dem Wächter
Ein Geräusch hinter ihm – so leise, dass es erst wie eine Erinnerung wirkte. Er fuhr herum. Im Schatten einer Säule löste sich eine Gestalt.
„Du suchst nach Antworten.“ Die Stimme war tief, rau, als sei sie zu lange in Kälte eingesperrt gewesen. „Wer sind Sie?“ Seine Finger krampften sich um das Amulett. Die Gestalt trat einen Schritt vor. Kapuze, dunkler Umhang. Nur die Augen sichtbar – hart wie geschliffenes Glas.
„Ein Wächter der alten Wege.“ „Das klingt nach einer Drohung.“ „Es ist eine Warnung. Wissen kann heilen. Aber es kann auch zerfetzen.“
Valerius spürte, wie ihm ein Tropfen Schweiß den Nacken hinablief. „Was wissen Sie über die Bruderschaft?“ „Genug, um dir zu sagen, dass du ihnen zu spät kommst – oder genau rechtzeitig, je nachdem, wer dich findet.“
Die Gestalt wandte sich zu einem Tisch, der im Halbdunkel stand. Darauf: eine alte Karte, Pergament so spröde, dass jeder Atemzug es zu zerreißen drohte. Ein rotes Symbol, geformt wie das Amulett, war darin eingezeichnet.
„Hier liegt die Wahrheit“, flüsterte der Wächter, und seine Stimme hatte nun etwas, das Valerius im Inneren frösteln ließ. „Und hier beginnt dein Kampf.“
Die Verdichtung der Schatten
Draußen zog der Nebel dichter. Das Flackern der Kerze warf unruhige Muster an die feuchten Wände, Muster, die sich bewegten, als hätten sie ihr eigenes Leben. Etwas klang wie ein leises Klopfen unter dem Boden. Oder war es sein Herz?
Valerius verstand, dass er einen Schritt weiter gegangen war – vielleicht zu weit. Venedig, diese Stadt aus Wasser und Stein, schien ihn jetzt zu betrachten. Und in den Tiefen ihrer Kanäle und Kellergemächer wartete etwas, das nicht schlafen konnte.
Kapitel 11: Die Masken Venedigs
Die Ankunft
Venedig lag unter einer Glocke aus Nebel, als Valerius aus der kleinen Fähre trat. Das Wasser glitt träge, schwarz wie Öltinte, und schien keinen Wellenschlag zu kennen. Der Nebel umschloss die Stadt wie ein zu eng geschnürtes Korsett – man konnte kaum sagen, wo das Wasser aufhörte und die Luft begann.
Der Geruch war eine Mischung aus Salz, altem Holz und einer leisen, modrigen Süße, die aus jahrhundertealten Kanälen stieg. Valerius zog den Mantelkragen hoch. Das Gefühl in seinem Nacken – dieses unablässige, lauernde Ziehen – war stärker geworden, seit er den ersten Schritt auf die Planken gesetzt hatte.
Erste Wege
Er nahm eine der schmalen Gassen. Die Wände der Häuser ragten dicht zusammen, feucht von jahrzehntelangem Atem des Meeres, mit abblätterndem Putz, der wie alte Haut herabhing. Von irgendwo drang das leise Klatschen eines Ruders an sein Ohr, gedämpft wie ein Herzschlag unter Wasser.
Zweimal musste er abrupt stehenbleiben – einmal, weil eine Gestalt im Nebel an ihm vorbeiglitt, ohne Geräusch, und einmal, weil eine Maske in einem Schaufenster ihm plötzlich so nah vorkam, als hätte sie sich eben noch bewegt.
Das Zimmer im Palast
Er mietete sich in einem einst prächtigen Palast ein, dessen Fassade im Schatten versank. Die Empfangshalle war leer, der Boden knarrte unter seinen Schritten. Der Schlüssel zu seinem Zimmer war aus schwarzem Eisen, kalt wie ein Stück Nacht.
Das Zimmer selbst war niedrig, die Decke schief, als hätten die Jahre sie niedergedrückt. Ein Fenster ging auf einen stillen Kanal hinaus, wo das Wasser gegen die Steine schlug, langsam, unbarmherzig. Der Geruch von feuchtem Holz und Staub war so dicht, dass er ihn beinahe schmecken konnte.
Er legte das Amulett auf den Tisch – mitten zwischen seine Notizen und die Karte, die er aus dem Palazzo des Wächters mitgenommen hatte.
Die Suche
Die nächsten Tage waren ein Spiel aus Fragen und Schweigen. Valerius sprach mit alten Buchhändlern, deren Finger gelb waren vom Nikotin und deren Augen jede Frage prüften, als steckte Gift darin.
„Die Bruderschaft?“ – ein alter Händler lachte trocken, wie Pergament, das zerbricht. „Nur Touristenmärchen.“ „Und doch kennen Sie das Symbol?“ Valerius zog eine Skizze aus seiner Tasche. Der Mann sah kurz hin, viel zu kurz, und antwortete nicht. Stattdessen drehte er die Skizze um und schob sie ihm zurück. „Manche Türen bleiben besser zu.“
Bei einem Fischer am Hafen, dessen Haut von Salz und Sonne gezeichnet war, erntete er nur ein Kopfschütteln. „Manchmal“, murmelte der Fischer, „fragt man nicht, wer im Wasser schwimmt, wenn man nicht mit hineingezogen werden will.“
Die Masken
Am dritten Abend ging Valerius an einer Reihe kleiner Läden vorbei, die Masken verkauften – in Gold, mit bunten Federn, aus schlichtem Leder oder Porzellan. Er blieb vor einem besonders alten Schaufenster stehen. Zwischen den üblichen Karnevalsmasken stand eine, die anders war: völlig weiß, ohne Mund, nur mit zwei tiefen, schmalen Öffnungen für die Augen.
Eine Stimme hinter ihm: „Sie sehen mehr, als du denkst.“ Valerius fuhr herum. Eine Frau, in Schwarz gekleidet, eine einfache Halbmaske vor dem Gesicht. „Was meinen Sie?“ „Masken verbergen nicht nur… sie zeigen auch. Aber nur denen, die wissen, wie man hinschaut.“
Er trat näher. „Und Sie wissen das?“ „Ich weiß genug, um dir zu sagen, dass du beobachtet wirst.“ Bevor er etwas erwidern konnte, war sie im Nebel verschwunden.
Die Nacht
In der vierten Nacht konnte er nicht schlafen. Das Flüstern in den Gassen drang bis in sein Zimmer, ein Rauschen wie von Stimmen, die gerade eben zu leise sprachen, um verstanden zu werden. Er ging zum Fenster – die Gasse war leer, aber er spürte den Blick.
Er setzte sich an den Tisch, nahm die Karte. Die Linien darauf wirkten im Kerzenschein wie Adern, die pulsieren. In der Ecke, fast unsichtbar, das Symbol des Löwen. Und daneben eine Inschrift, kaum zu lesen: Chi guarda dietro la maschera, rischia di non tornare – Wer hinter die Maske blickt, riskiert, nicht zurückzukehren.
Er lehnte sich zurück. Draußen schlug eine Gondel leise gegen den Kai. Und irgendwo, ganz nah, klirrte etwas – als hätte jemand eine Porzellanmaske auf den Boden fallen lassen.
Kapitel 12: Der alte Gondoliere
Die Stadt im Würgegriff des Nebels
Venedig war an diesem Tag kaum mehr als ein träge atmender Schatten. Ein bleierner Himmel hing wie eine drohende Hand über den Dächern, drückte auf jede Gasse, jeden stillen Kanal. Das Grau war so tief, dass die Welt fast farblos wirkte. Das Wasser der Kanäle trug denselben fahlen Ton wie der Himmel, als hätten sie sich verschworen, alles Licht zu ersticken.
Valerius’ Schritte klangen hohl auf dem unebenen Pflaster, das an manchen Stellen von einer dünnen Schicht glitschigen Algenschleims überzogen war. Von irgendwoher drang das ferne Kreischen einer Möwe – langgezogen, heiser, wie ein Laut, der eine Warnung sein könnte.
Er hielt den Blick nach vorne gerichtet, aber die Augen seiner Erinnerung wanderten in alle Richtungen zugleich. Seit Tagen war er in den Schatten der Stadt unterwegs, den Kopf voller bruchstückhafter Hinweise, die Finger kalt und taub vom feuchten Wind. Keine Spur, kein Name, nur das dumpfe Gefühl, dass er beobachtet wurde.
Leere Wege und hungrige Schatten
Die Gassen, durch die er ging, schienen sich zu verengen, als hätte die Stadt beschlossen, ihn zu verschlucken. Er passierte Türen, hinter denen kein Leben zu existieren schien. Verschlossene Fensterläden, von der Feuchtigkeit aufgequollen und von Rissen gezeichnet, starrten ihn an wie blinde Augen.
Einmal blieb er stehen, weil er schwor, leise Schritte hinter sich gehört zu haben. Doch als er sich umdrehte, war da nur Nebel, der sich langsam wie träger Rauch in den Biegungen der Gassen verzog.
Die Entdeckung am Kanal
Er fand den alten Gondoliere zufällig. Ein schmaler Torbogen öffnete sich zu einem kleinen Seitenkanal, den kaum ein Tourist je betreten haben dürfte. Die Mauern hier waren schwarz vor Alter und Feuchtigkeit, und von oben tropfte Wasser, das mit dumpfem Plopp in den Kanal fiel.
Auf einer niedrigen Anlegestelle saß er: gebeugt, reglos, die Hände wie Wurzeln ineinander verschränkt, den Blick auf die träge Wasserfläche gerichtet. Die Gondel, an der er lehnte, war uralt – das Holz so dunkel, dass es fast schwarz wirkte, und mit winzigen Kerben bedeckt, als hätte jemand jahrzehntelang still Zeichen hineingeschnitten.
Erste Worte
Valerius näherte sich vorsichtig, das Pflaster unter seinen Schuhen gab ein knirschendes Geräusch von sich. „Entschuldigung…“, begann er, und seine Stimme war kaum mehr als ein Raunen. „Ich suche nach… den Verborgenen. Nach den Brüdern. Oder… wer auch immer hier die Schatten kennt.“
Der Gondoliere hob langsam den Kopf, als würde jede Bewegung Kraft kosten. Seine Augen waren von einem unheimlichen Grau – nicht leer, aber so alt, dass sie die Gegenwart nur noch als dünnen Schleier über einer tieferen, dunkleren Realität zu sehen schienen.
„Manchmal,“ begann der Alte, und seine Stimme war rau wie nasses Papier, „liegen die größten Geheimnisse nicht in Büchern, nicht in Hallen aus Stein, sondern…“ – er legte eine lange Pause ein, als müsse er die Worte suchen – „…in den Herzen jener, die gelernt haben, die Nacht zu überleben.“
Der Fingerzeig
Er drehte den Kopf kaum merklich und hob dann eine Hand, in der die Haut so dünn war, dass die blauen Adern wie Flussläufe hervortraten. Langsam, fast feierlich, zeigte er auf eine schmale Gasse, die noch tiefer im Nebel lag. Dort war eine Tür zu erkennen – niedrig, unscheinbar, aus Holz, das so alt war, dass es fast mit der Mauer verwachsen wirkte. Kein Schild, kein Griff, nur ein eisernes Scharnier, das von Rost zerfressen war.
„Dort…“, flüsterte er, „findest du, was du suchst. Aber hör gut zu: Der Weg der Löwen ist… steinig, blutig… und voller Augen, die nie blinzeln.“
Valerius’ Blick folgte dem Finger, und er spürte einen Kältestrom, der nichts mit dem Wetter zu tun hatte.
Die Warnung des Alten
„Und nur die Mutigen… oder die Verrückten… gehen ihn bis zum Ende“, fügte der Gondoliere hinzu. „Was passiert mit den anderen?“ Ein schmaler Zug ging über das Gesicht des Alten – vielleicht ein Lächeln, vielleicht nur ein Zucken. „Sie werden Teil der Stadt. Manche sagen, man hört ihre Stimmen im Nebel. Ich… höre sie oft.“
Valerius schluckte. „Warum helfen Sie mir?“ Der Alte senkte den Blick zum Wasser. „Manchmal muss man einen Stein ins Wasser werfen, um die Fische zu sehen. Vielleicht bist du dieser Stein.“
Die Schwelle
Ein Schweigen legte sich zwischen sie, schwer und fast körperlich. Valerius nickte nur und flüsterte ein knappes „Danke“, bevor er sich zur Gasse wandte. Er fühlte den Blick des Alten in seinem Rücken, so deutlich, dass er sich fast umdrehte – doch er tat es nicht.
Die Tür war kalt unter seinen Fingern. Als sie sich öffnete, strömte ihm ein scharfer Geruch entgegen – Moder, altes Holz, und etwas Eisenhaltiges, das ihn an Blut erinnerte. Ein Windzug fuhr durch den Gang dahinter, brachte die Flamme seiner kleinen Laterne zum Zittern.
Das Verschwinden
Bevor er die Dunkelheit betrat, drehte er sich noch einmal um. Der Anlegesteg lag verlassen da. Die Gondel war fort. Nur der Nebel hing schwer über dem Wasser, unbewegt wie ein Leichentuch.
Valerius atmete tief durch. Dann setzte er den Fuß über die Schwelle.
Kapitel 13: Die Bruderschaft des Löwen
Die Schwelle
Die Tür, die der Gondoliere ihm gezeigt hatte, war kein bloßer Eingang. Sie war eine Grenze – nicht nur aus Holz und Eisen, sondern aus Zeit, Geheimnis und etwas, das älter war als die Stadt selbst. Valerius’ Hand lag auf dem Griff, kalt wie ein Stück Metall, das zu lange im Winterwind gelegen hatte. Er spürte, wie sich seine Finger verkrampften, als würde die Tür selbst ihm zuflüstern: Überlege es dir gut.
Ein Atemzug. Dann drückte er. Das Scharnier ächzte, als würde es den Eindringling verfluchen.
Der Gang
Hinter der Tür lag ein schmaler Korridor, kaum breiter als seine Schultern. Die Wände waren mit Symbolen bedeckt – Kreise, Linien, verschlungene Zeichen, die aussahen, als wären sie mit Ruß und Blut gemalt worden. Das matte Licht einer einzelnen Kerze flackerte an der Wand, warf Schatten, die sich bewegten wie Gestalten, die ihm folgten.
Der Geruch war schwer: Staub, feuchtes Holz, und darunter ein metallischer Hauch, der ihn an altes Eisen erinnerte… oder an Blut. Der Boden knarrte unter seinen Schritten, als würde er auf den Rippen eines uralten Tieres gehen.
Die zweite Tür
Am Ende des Ganges stand eine massive Holztür, dunkel wie verkohltes Holz, mit Eisenbeschlägen, die wie Krallen geformt waren. Valerius hob die Hand und klopfte. Der dumpfe Klang hallte zurück, als würde er in einen tiefen Brunnen fallen.
Ein kleiner Spion öffnete sich. Ein Paar Augen erschien – kalt, wachsam, prüfend. „Name.“ „Valerius von Falkenberg.“ Eine Pause. „Und?“ „Sohn von Helena von Falkenberg.“
Die Augen verengten sich. Ein leises Schaben, dann schloss sich der Spion.
Der Rat der Löwen
Die Tür öffnete sich langsam. Der Raum dahinter war groß, aber das Licht der Kerzen reichte nicht bis in die Ecken. Ein langer Holztisch stand in der Mitte, umgeben von Männern und Frauen, deren Gesichter von den Jahren und den Geheimnissen gezeichnet waren. Ihre Augen folgten ihm, prüfend, abwägend – als würden sie nicht nur ihn sehen, sondern auch das, was hinter ihm stand.
In der Mitte erhob sich ein älterer Mann. Sein Bart war silbern, sein Blick schwarz wie polierter Obsidian. Er trat vor, jeder Schritt gemessen, als trüge er das Gewicht von Jahrhunderten.
„Valerius von Falkenberg“, sagte er, und seine Stimme war tief wie das Grollen eines nahenden Gewitters. „Deine Mutter war eine Legende unter uns. Wir wussten, dass du eines Tages kommen würdest.“
Die Enthüllung
Valerius’ Herz schlug schneller. „Dann wissen Sie, warum ich hier bin.“ Der Alte nickte kaum merklich. „Wir wissen mehr, als du ahnst. Über dich. Über sie. Über das, was dich jagt.“ Ein Murmeln ging durch die Versammlung. Eine Frau mit scharf geschnittenem Gesicht und Augen wie kaltes Glas beugte sich vor. „Du trägst das Amulett?“ Valerius griff in seine Tasche, legte es auf den Tisch. Die Kerzenflammen zuckten, als hätte das Metall ihnen den Atem geraubt.
„Es ist nur die Hälfte“, sagte die Frau. „Die andere…“ – sie sah zu einem Mann am Ende des Tisches – „…ist verloren. Oder schlimmer: gefunden.“
Die Warnung
Der Alte trat näher, seine Stimme nun leiser, aber schärfer. „Rumanja Katadka kennt deinen Namen. Sie kennt dein Gesicht. Und wenn sie dich noch nicht gefunden hat, dann nur, weil sie will, dass du glaubst, du hättest Zeit.“ Er legte eine Hand auf das Amulett. „Dieses Artefakt ist ein Schlüssel. Aber Schlüssel öffnen Türen – und manche Türen sollten für immer verschlossen bleiben.“
Valerius spürte, wie sich die Schatten im Raum verdichteten. Er wusste, dass er hier nicht nur Antworten finden würde, sondern auch neue Fragen – Fragen, die ihn tiefer in die Dunkelheit ziehen würden, als er je geplant hatte.
Der Schwur
„Willst du den Weg gehen, den deine Mutter begonnen hat?“ fragte der Alte. Valerius sah in die Gesichter um den Tisch. Misstrauen. Hoffnung. Furcht. „Ja“, sagte er schließlich. „Egal, wohin er führt.“
Ein leises, zustimmendes Murmeln ging durch den Raum. Die Frau mit den kalten Augen lächelte – ein Lächeln ohne Wärme. „Dann beginnt deine Jagd jetzt.“
Kapitel 14: Die Legende des Sternenstaubs
Der Raum der Löwen
Der Sitzungssaal der Bruderschaft lag tief unter den Fundamenten Venedigs, irgendwo zwischen dem Atem der Kanäle und der Fäulnis vergessener Jahrhunderte. Die Mauern waren uneben und feucht, schwarz gefärbt vom Hauch der Lagune. Nur eine alte Petroleumlampe brannte in der Mitte des massiven Eichentisches – eine Lampe, deren Glas milchig war von Ruß und Jahrzehnten. Ihr Licht war schwach, gelblich, zitternd. Es reichte nicht, die Ecken des Raumes zu erhellen, und so konnte Valerius nur erahnen, ob er von zwei Dutzend Augen oder von etwas anderem, Unsichtbarem, beobachtet wurde.
Der Geruch nach Öl, Leder und altem Metall lag schwer in der Luft. Jedes leise Knacken im Holz, jedes Tropfen von irgendwoher, wurde hier unten von den Wänden aufgefangen und zurückgeworfen.
Die Karte
Auf dem Tisch lag eine Karte. Sie war kein einfaches Stück Pergament – sie sah aus, als wäre sie aus gegerbter Haut gefertigt, ihr Rand ausgefranst, stellenweise verbrannt. Linien, Symbole, alchemistische Zeichen durchzogen sie wie ein Spinnennetz. Manches davon leuchtete schwach im Lampenschein, als hätte die Tinte Phosphor getrunken.
Valerius beugte sich vor, doch ehe er einen der seltsamen Schriftzüge berühren konnte, legte der Älteste seine knochige Hand darauf. Die Adern traten hervor wie Wurzeln unter trockener Erde.
„Der Sternenstaub…“ Seine Stimme war tief, rau, doch nicht schwach. Es war, als spräche jemand, der sehr lange geschwiegen hatte und nun jedes Wort sorgfältig aus einer Truhe voller Geheimnisse holte.
„Er ist keine Legende. Er ist älter als jede Schrift, älter als die Städte, in denen wir leben. Er ist das, was übrig bleibt, wenn ein Stern stirbt und weint.“
„Weint?“ fragte Valerius leise. Seine Stimme hallte zu laut in seinen eigenen Ohren. Der Älteste nickte, ohne den Blick zu heben. „Ja. Sterne können weinen. Ihre Tränen fallen nicht als Regen… sondern als Staub, der brennt, wenn er das Fleisch der Verdammten berührt.“
Rom und seine Wächter
„Der einzige Ort, an dem dieser Staub noch existiert“, fuhr der Älteste fort, „liegt unter dem Kolosseum in Rom. Eine Kammer, älter als der Bau selbst. Dort halten ihn die Wächter des Ewiglichts.“
Bei diesen Worten veränderte sich die Stimmung im Raum. Zwei der Männer am Tisch warfen einander flüchtige, nervöse Blicke zu. Eine Frau mit grauem Zopf presste die Lippen zusammen.
„Ihr wart ihnen schon einmal begegnet“, sagte sie an Valerius gewandt. „Ohne es zu wissen.“ „Wächter?“ „Sie sind keine Menschen mehr. Sie sind… Überbleibsel. Augen, die die Dunkelheit sehen, Hände, die den Staub beschützen, auch wenn sie längst Staub sein sollten.“
Valerius’ Nacken prickelte. Er erinnerte sich an ein Gefühl, verfolgt zu werden – schon vor Venedig.
Mehr als eine Waffe
„Der Sternenstaub allein reicht nicht“, sagte nun die Frau. „Er raubt den Vampiren die Unsterblichkeit, macht sie verwundbar… aber er löscht sie nicht aus.“ Der Älteste nickte. „Dafür brauchst du den zweiten Schlüssel: das Herz der Leere.“
Valerius’ Stimme war kaum hörbar. „Und wo?“ „In Ägypten“, sagte der Älteste und legte jedes der vier Silben wie einen Stein auf den Tisch. „In einem Tempel, den selbst die Sonne meidet. Dort, wo der Sand niemals warm ist.“
Ein Mann mit einer tiefen Narbe über der Wange fügte hinzu: „Das Herz ist… nichts. Wirklich nichts. Ein Stück reines Nichts, so alt, dass man nicht weiß, ob es jemals ‚erschaffen‘ wurde. Es frisst Licht. Es frisst Gedanken. Manche sagen, es frisst auch den, der es zu lange hält.“
Die Warnung
„Wenn du es findest,“ sagte der Älteste leise, „wird es dich rufen. Es wird dir versprechen, alles zu geben, was du brauchst, um Rumanja zu besiegen. Aber du wirst zahlen. Mit Stücken von dir selbst. Und nicht alle davon kannst du zurückholen.“
Valerius schwieg. Er spürte ihre Blicke. Kalt, prüfend. Nicht, ob er bereit war – sondern wie lange er wohl durchhalten würde.
Das letzte Geheimnis
„Und wenn ich beides habe? Sternenstaub und Herz?“ Der Älteste lächelte ohne jede Wärme. „Dann öffnet das vereinte Amulett ein Tor. Nicht einfach in eine andere Welt… in eine, in der ihre Macht gefesselt ist. Aber auch du wirst dort gefesselt sein. Die meisten, die gehen, kommen nicht zurück. Manche kommen zurück – aber sind nicht mehr sie selbst.“
Eine Pause. Man hörte nur das Knistern des Lampendochts.
„Es ist nicht nur Rumanja, die du bekämpfst“, sagte er schließlich. „Es ist auch der Teil von dir, der ihr gleicht. Wir alle tragen Dunkelheit. Das Herz der Leere… zeigt sie dir. Ohne Schleier.“
Der Entschluss
Valerius atmete langsam aus. Er wusste, dass er nicht gehen konnte, ohne zuzustimmen. „Sagt mir, was ich tun muss.“
Das Murmeln im Raum schwoll kurz an, dann wurde es wieder still. Die Frau mit dem Zopf lächelte schmal. „Dann beginnt deine Reise mit Rom.“ „Und endet?“ „Wenn du Glück hast, mit dem Tod. Wenn du Pech hast, mit etwas… anderem.“
Valerius erhob sich. Die Schatten an den Wänden schienen sich zu bewegen, als ob etwas hinter ihnen lächelte.
Kapitel 15: Rom, die Ewige Stadt
Der Nebel hing wie schmutziger Atem in den Straßen, als Valerius den Fuß auf das Kopfsteinpflaster Roms setzte. Die Nacht hatte die Stadt vollständig verschluckt, und selbst die wenigen Laternen wirkten nicht wie Lichtquellen, sondern wie trübe Augen, die ihn misstrauisch musterten. Rom war mehr als eine Stadt – es war eine Kreatur aus Fleisch und Stein, deren Adern die jahrtausendealten Gassen waren, in denen das Blut der Geschichte langsam floss.
Ein Windstoß trug den Geruch von nassem Marmor, altem Wein und etwas Bitterem mit sich, das Valerius nicht zuordnen konnte. Vielleicht war es nur Einbildung. Vielleicht auch nicht.
Erste Begegnungen in der Dunkelheit
„Verlaufen sollte man sich hier nicht…“ Die Stimme kam aus einer Seitengasse, rau und von jahrelangem Tabak gezeichnet. Aus dem Schatten trat ein alter Mann, in einen langen Mantel gehüllt, dessen Saum von Schmutz und Regen dunkler gefärbt war. Er trug einen zerdrückten Filzhut, unter dem seine Augen wie glühende Kohlen funkelten.
„Ich verlaufe mich nicht“, entgegnete Valerius knapp. „Oh doch“, grinste der Alte, „nur weißt du es noch nicht.“ Er deutete mit dem Kopf in Richtung einer schmalen Treppe, die in die Tiefe führte. „Da unten findest du, was du suchst… oder was dich sucht.“
Valerius wollte etwas erwidern, doch der Mann war schon wieder im Nebel verschwunden – als hätte er nie existiert. Nur das langsame Klopfen eines Stocks auf dem Pflaster hallte noch nach, bis es verstummte.
Das Kolosseum
Schließlich ragte es vor ihm auf – das Kolosseum. Im fahlen Mondlicht wirkte es weniger wie eine Ruine, sondern wie ein schlafender Gigant, dessen Rippen aus geborstenen Bögen und Mauern bestanden. Ein Hauch von kalter Energie strömte aus den Spalten im Mauerwerk, als atmete das Bauwerk selbst.
Valerius legte eine Hand an den Stein. Sofort spürte er ein leises Vibrieren, als würde unter der Oberfläche etwas leben. Für den Bruchteil einer Sekunde flackerte vor seinem inneren Auge das Bild eines Mannes auf – blutüberströmt, in Rüstung, das Schwert erhoben. Dann war es verschwunden.
„Sie sehen dich, weißt du?“ Eine Frau war aus den Schatten getreten, jung, aber mit einem Blick, der alt wirkte. „Die Wächter. Sie wissen, dass du hier bist.“
„Und wer bist du?“ „Nur jemand, der schon zu lange hier unten hört, wie die Mauern flüstern. Folge mir – oder geh allein weiter und stirb schneller.“
Die Katakomben
Sie führte ihn zu einem unscheinbaren Gitter, versteckt zwischen zwei verfallenen Bögen. Dahinter begann ein schmaler Gang, feucht und modrig. Das Wasser tropfte in unregelmäßigen Abständen von der Decke, jeder Tropfen wie ein Uhrschlag in der Stille.
„Die Katakomben ändern sich“, sagte sie, während sie eine Kerze entzündete. „Manchmal sind sie gnädig. Meistens nicht.“
Die schmalen Gänge schienen tatsächlich zu atmen. Schatten krümmten sich wie Gliedmaßen, und aus der Ferne klang etwas, das wie das Wispern vieler Stimmen wirkte. Der Boden knirschte unter Valerius’ Stiefeln – nicht Stein, nicht Erde, sondern etwas, das knochiger war.
„Und die Wächter?“ fragte er leise. „Sie sind alt. Älter als die Bruderschaft des Löwen. Manche sagen, sie seien nie geboren worden. Sie… warten. Immer.“
Zeichen der Stadt
Je tiefer sie gingen, desto stärker wurde der Geruch – nicht nur von Moder, sondern von etwas Eisenhaltigem, das wie ein alter Blutfleck in der Luft hing. Valerius’ Finger tasteten über Wandritzungen: lateinische Inschriften, vermischt mit Symbolen, die er nicht kannte. Manche Zeichen wirkten frisch eingeritzt, als hätten sie sich von selbst erneuert.
„Siehst du das?“ Die Frau deutete auf ein Mosaik, das halb im Dunkeln lag: Ein Kreis aus goldenem Sternenstaub, eingefasst in schwarzem Stein. „Man sagt, es sei der Wegweiser zum Herz der Leere.“
Valerius beugte sich vor. Für einen Augenblick schwor er, ein schwaches Pulsieren im Mosaik zu sehen – als würde es ihn erkennen.
Die Prüfung
Plötzlich verstummte das Wispern. Die Dunkelheit wirkte schwerer, dichter. Hinter ihnen hallte ein Schritt – dann ein zweiter. „Wir sind nicht allein“, flüsterte die Frau, und ihre Hand glitt an den Dolch in ihrem Gürtel.
Aus dem Schatten trat eine Gestalt in einer Umhüllung, deren Stoff wie aus flüssigem Schwarz gewebt schien. Das Gesicht lag in tiefer Kapuze verborgen, nur zwei gelbe Augen schimmerten heraus.
„Valerius“, sprach sie, ohne die Lippen zu bewegen – oder waren es überhaupt Lippen? „Du suchst, was nicht gefunden werden will.“
„Ich suche die Wahrheit“, erwiderte er. „Wahrheit“, murmelte die Gestalt, „ist ein Messer ohne Griff. Du kannst sie führen – aber nicht, ohne dich selbst zu schneiden.“
Ende des Weges – vorerst
Der Gang hinter der Gestalt war in gleißendes Weiß getaucht, das wie ein ferner Ausgang wirkte – oder wie der Schlund eines gigantischen Tieres. Die Frau sah Valerius an. „Wenn du weitergehst, gibt es kein Zurück.“
Er atmete tief durch und trat vor.
Hinter ihm fiel die Dunkelheit wie eine Tür ins Schloss. Vor ihm lag Rom – nicht das Rom der Menschen, sondern das Rom seiner Geister, seiner Wächter und seiner uralten Versprechen. Die Jagd hatte begonnen. Aber die Stadt spielte nach ihren eigenen Regeln – und sie hatte noch nie verloren.
Kapitel 16 – Die Wächter des Ewiglichts
Die schwere Holztür fiel mit einem dumpfen, langen Knarren ins Schloss, als wolle sie Valerius endgültig von der Welt dort draußen trennen. Das Geräusch war so laut in der gedämpften Finsternis, dass es sich in seinem Schädel verfing und nachzitterte wie ein gebrochener Glockenschlag. Er stand am Anfang eines schmalen, beklemmenden Korridors. Das einzige Licht kam von seiner Taschenlampe, deren Strahl tanzend über feuchte Steinwände huschte. Das Mauerwerk glänzte von jahrhundertelangem Schwitzwasser, und in den dunkleren Fugen klebte ein flockiger, graugrüner Belag, der nach faulendem Laub und kaltem Metall roch.
Das Bauwerk unter dem Kolosseum war älter als die meisten Legenden darüber. Man hatte hier unten Dinge aufbewahrt, vor denen selbst die Mächtigen der Welt zurückgeschreckt waren – Relikte, deren Bedeutung so gefährlich war, dass sie nicht einmal im Flüsterton unter Eingeweihten erwähnt wurden. Der Grundriss war ein knochenweißes Labyrinth, das nur Wahnsinnige oder jene betraten, die nichts mehr zu verlieren hatten.
Die verborgene Öffnung
Links, verborgen hinter einer Nische, tastete Valerius die Wand ab. Er spürte die lose Steinplatte, deren Kante sich leicht hob. Als er dagegen drückte, löste sie sich fast lautlos – als wüsste sie, dass er kommen würde. Dahinter gähnte eine Öffnung, schmal genug, dass er sich seitlich hindurchzwängen musste. Kalte Luft strömte heraus, dick wie Nebel, und trug einen muffigen Geruch mit sich, der an uralte Grabkammern erinnerte.
Die schmale Wendeltreppe dahinter schraubte sich in den Abgrund. Jeder Schritt nach unten ließ die Temperatur sinken, und der Stein unter seinen Füßen war feucht und rutschig. Ein leises Tropfen war zu hören – regelmäßig, wie ein Herzschlag, nur viel zu langsam. Mit jedem Tritt hatte er das Gefühl, etwas unsichtbar Lebendiges dränge sich dichter an seine Haut.
Der Raum der Wächter
Unten öffnete sich die Treppe in eine Kammer, die nicht groß war und doch eine unbeschreibliche Präsenz hatte. Die Wände waren komplett überzogen von pergamentfarbenen Bahnen mit handgemalten Zeichen, verblasst, aber nicht gebrochen. Manche Schriftzüge glommen schwach im Kerzenschein, als würden sie Hitze speichern.
Kerzen – Dutzende – standen in eisernen Haltern und tropften Wachs wie erstarrte Blutstropfen auf den Steinboden. Das Licht war warm und doch zu schwach, um die Ecken auszuleuchten, wo die Schatten ineinander flossen.
In der Mitte saßen Männer und Frauen in Kreisformation. Ihre Roben – tiefe, matte Grautöne, vom Licht nur sanft gestriffen – wirkten, als seien sie aus gewebter Asche gefertigt. Sie bewegten sich nicht. Kein Blinzeln, kein Zucken der Hände. Manche hielten die Augen geschlossen, andere starrten ins Nichts. Doch das Auffälligste waren ihre Augen, wenn sie einen ansahen: ein Blick, so alt und so klar, dass er durch Haut und Knochen drang.
Der Anführer
Aus dem Kreis erhob sich ein Mann – so langsam, dass Valerius nicht sagen konnte, ob er stand oder schwebte. Sein Bart war von so reinem Weiß, dass er im Kerzenlicht beinahe bläulich schimmerte. Die Gesichtsfalten waren tiefe Schluchten, die nicht nur von Jahren, sondern von Erlebnissen gegraben schienen.
„Wir haben auf dich gewartet, Valerius von Falkenberg“, sagte er, und jedes Wort war leise, aber getragen von einer Schwere, die im Brustkorb nachhallte. „Lange gewartet.“ Die Betonung lag auf lange, als sei die Zeit selbst für diesen Mann nur eine geduldige Dienerin.
Valerius nickte knapp. „Dann wissen Sie, weshalb ich hier bin.“
Der Alte musterte ihn – nicht prüfend, sondern ergründend, als sei Valerius ein Manuskript, dessen verborgene Botschaft er in diesem Moment zu entziffern begann. „Der Sternenstaub ist bereit. Aber er ist kein Geschenk. Er ist eine Prüfung, und du bist nur ein möglicher Träger.“
Die Übergabe
Der Alte hob die Hand, und aus dem Kreis trat eine Frau mit glatten, schwarzen Haaren, die auf der Haut wie Pech glänzten. In ihren Händen lag eine winzige Ampulle, versiegelt mit einem dunklen Wachs. Das Glas wirkte dünn, verletzlich – und doch schien das silbrig schimmernde Pulver darin das Material zusammenzuhalten. Jedes Partikel funkelte, als hätte es den Sturz eines Sterns miterlebt.
„Der Staub der gefallenen Sterne“, murmelte der Alte, „eingefangen, bevor er den Atem der Welt verlieren konnte.“
Valerius spürte, wie sein Herzschlag schwerer wurde. „Wird er sie… töten?“, fragte er, ohne den Blick von der Ampulle zu nehmen.
„Töten?“ Ein kurzes, beinahe trauriges Lächeln zog über das Gesicht des Alten. „Nein. Er bricht, was nicht brechbar scheint. Er raubt das, was sie unbesiegbar macht. Aber er tötet nicht. Töten ist eine Entscheidung, kein Naturgesetz.“
Warnung
Der Alte trat näher, so nah, dass Valerius den Geruch von altem Pergament und kaltem Rauch wahrnahm. „Das Feuer in den Händen eines Kindes kann Häuser wärmen… oder sie verbrennen. Der Staub ist dieses Feuer. Du wirst entscheiden, ob er wärmt oder zerstört. Du allein.“
„Und wenn ich versage?“ „Dann verlierst nicht nur du. Dann verliert alles.“
Ein Murmeln ging durch den Kreis. Nicht bedrohlich – eher wie das Seufzen vieler, die eine Wahrheit bereits kennen. Ein Mann mit eingefallenen Wangen sprach aus dem Halbdunkel: „Wer den Staub trägt, trägt auch den Blick der Sterne. Und die Sterne blinzeln nicht.“
Der Moment
Valerius streckte schließlich die Hand aus. Die Ampulle war kalt, fast klamm, als läge sie schon zu lange in der Hand eines Toten. Der Verschluss knirschte, als er ihn löste – und ein Geruch strömte hervor, den er nicht hätte benennen können. Süß, metallisch, alt. Alt wie Felsen. Alt wie das Schweigen zwischen Herzschlägen.
Die Schatten an den Wänden bewegten sich, krümmten sich, und für einen Sekundenbruchteil meinte er, Gesichter darin zu sehen – Gesichter, die er nie zuvor gesehen hatte und doch kannte. Flüsternde Stimmen – zu leise, um die Worte zu fassen – kräuselten die Luft.
Valerius wusste: Mit diesem Atemzug hatte er eine Schwelle überschritten. Die Wächter hatten ihm gegeben, wonach er suchte. Und sie hatten ihm etwas genommen – etwas, das er noch nicht benennen konnte. Vielleicht war es ein Teil seiner Sicherheit. Vielleicht ein Teil seiner Seele.
Und irgendwo in dieser Kerzenkammer, verborgen zwischen den tanzenden Schatten, lächelte etwas Unsichtbares.
Kapitel 17: Paris im Schein der Laternen
Der Himmel über Paris hing tief wie eine schwelende Decke aus Pech. Dicke Wolken zogen träge über die Stadt, als würden sie nicht vom Wind bewegt, sondern von einer unmerklichen, eigenen Macht. Der Regen war längst verklungen, doch in den Gassen hing noch der Geruch nassen Steins – dieser einzigartige, kalte Duft, der wie das Ausatmen der Vergangenheit wirkte. Valerius hatte den Kragen seines Mantels hochgeschlagen, nicht so sehr wegen der Kälte, sondern um das Gewicht seiner Gedanken zu verbergen. In der Tasche, direkt an seiner Seite, lag die kleine, versiegelte Ampulle mit dem Sternenstaub. Sie war kaum schwerer als eine Münze – und doch fühlte es sich an, als hätte er einen Mühlstein aus Verantwortung bei sich.
Die Stadt als Kreatur
Die Laternen entlang der Rue des Mauvais Anges warfen Licht, das mehr verschluckte als erhellte. Unter ihnen lag Paris wie eine schlafende Bestie, und der schwache, honigfarbene Schein der Gasflammen ließ die Fassaden der Häuser wirken wie uralte Gesichter. Die schmiedeeisernen Balkone waren die eingefrorenen Grimassen dieser steinernen Masken, und hinter den geschlossenen Fenstern lauerte eine Stille, die nicht menschlich war.
In einer Seitenstraße, die zu einem vergessenen Teil des Marais führte, öffnete sich eine kleine Brasserie. Der Geruch von billigem Rotwein und verbranntem Fleisch quoll aus der Tür, gefolgt von den gedämpften Stimmen einer Handvoll Gestalten im Inneren. Valerius trat ein. Der Boden knarzte unter ihm, die Dielen waren so schief, dass das Glas auf dem Tresen leicht vibrierte.
Die Gerüchte säen
Hinter dem Tresen stand ein alter Mann mit einer Schürze, die mal weiß gewesen sein musste. Seine Augen waren grau und wässrig, doch sie blitzten auf, als er Valerius erkannte. „Monsieur Falkenberg… hier unten sehen wir selten Leute wie Sie.“ „Und was sehen Sie dann?“, erwiderte Valerius trocken. Der Alte zuckte mit den Schultern. „Ratten. Schatten. Gesichter, die man lieber vergisst. Und manchmal…“, er beugte sich vor, „…Gerüchte.“
Valerius ließ ein paar Münzen über den Tresen gleiten. „Dann lassen Sie dieses hier in der richtigen Kehle landen. Sagen Sie, dass das Amulett bald den Besitzer wechseln könnte. Sagen Sie, der Sternenstaub ist in der Stadt.“ Der Wirt schnaubte leise. „So eine Geschichte erzählt man nicht leichtfertig. Manche… hören genau hin.“ „Genau das will ich.“
Unterwelt der Stadt
Später, als er die Brasserie verließ, führte ihn der Weg zu einer schmalen Treppe aus schwarzem Stein, die in die Unterwelt von Paris hinabführte. Der Eingang war hinter einem halb eingestürzten Torbogen verborgen – kaum mehr als ein Spalt, durch den kühler, modriger Atem drang. Die Katakomben empfingen ihn mit einer Finsternis, die sich nicht einfach sehen ließ – sie war körperlich, wie ein schwerer Stoff, der ihm auf die Schultern fiel. An den Wänden stapelten sich Schädel, deren leere Augenhöhlen den Weg zu beobachten schienen. Feuchte Tropfen platschten in Pfützen, das Echo hallte lange nach.
Valerius bewegte sich vorsichtig, die Hand stets an der Wand, den Blick wachsam. Zwischen den Steinsäulen blitzte hin und wieder etwas auf – das Rascheln einer Ratte, das Zittern eines Schattens, das kein Schatten sein konnte.
Die Ahnung der Begegnung
Er wusste, dass Rumanja hier unten sein konnte. Er konnte sie fast riechen: dieser fremdartige Duft, süß und doch nach kaltem Eisen. Seine Nackenhaare stellten sich auf. Die Legende sagte, sie bewege sich lautlos, wie Rauch, und tauche dort auf, wo der Boden am weichsten unter den Füßen nachgab.
Ein Laut ließ ihn innehalten. Schritte – zu leicht, um menschlich zu sein, zu regelmäßig, um ein Tier. „Valerius…“ Die Stimme kam nicht aus einer Richtung, sondern aus allen. Sie war samtig, durchzogen von einem kaum hörbaren, grausamen Lächeln. „Du streust hübsche Geschichten. Ich habe sie gehört.“
Das erste Duell der Worte
Er blieb stehen, den Sternenstaub fest in der Hand. „Dann weißt du, weshalb ich hier bin.“ „Oh, ich weiß, weshalb du glaubst, hier zu sein“, erwiderte Rumanja. Ihre Silhouette trat langsam aus der Dunkelheit zwischen zwei Säulen hervor. Das Licht der Laterne, die er an einem Haken gelassen hatte, spiegelte sich in ihren Augen – zwei flüssige Splitter Mondlicht.
„Ein Bauer, der glaubt, die Königin herausfordern zu können“, fuhr sie fort. „Manchmal“, sagte Valerius leise, „schlägt ein Bauer die Königin – wenn sie nicht hinsieht.“ Ein Lachen, tief und ehrlich, entwich ihr. „Ich sehe immer hin.“
Das Versprechen
Sie trat näher, bis er den schwachen Duft ihres Parfüms wahrnahm – etwas Blumiges, das unterdrückte, was darunter lauerte: den Geruch von Blut. „Spiel deine Züge, Valerius. Aber vergiss nicht… ich setze nicht auf Gewinn. Ich spiele um Besitz.“
„Wir werden sehen, wer am Ende wem gehört“, antwortete er, und es überraschte ihn selbst, wie ruhig seine Stimme klang.
Die Nacht hält den Atem an
Für einen Moment war alles still. Kein Tropfen, kein Echo, nicht einmal das Rascheln einer Ratte. Paris hielt den Atem an, als wollte die Stadt selbst diesen Augenblick konservieren. Dann drehte sich Rumanja um, glitt in die Dunkelheit – und verschwand, als hätte sie sich im Stein aufgelöst.
Valerius blieb allein in den Katakomben zurück, das Herz hämmernd, den Sternenstaub in der Faust. Er wusste, dies war nur der erste Akt. Paris hatte ihnen die Bühne gegeben. Die Vorstellung hatte gerade erst begonnen.
Kapitel 18: Das Netz der Spuren
Paris schien in diesen Tagen nicht einfach eine Stadt zu sein, sondern ein riesiger Organismus, der Valerius prüfte, maß, wog… und womöglich verdammen wollte. Die Morgende waren bleiern; ein fahler Himmel hing wie eine bleiche Wunde über den Dächern, und das Licht, das durch die engen Gassen sickerte, wirkte schwach, als hätte es Angst, den Boden zu berühren. Der Geruch von frisch gefallenem Regen haftete noch auf den Pflastersteinen der alten Plätze, gemischt mit dem dumpfen Aroma feuchten Metalls. Selbst in den Momenten, in denen nichts zu sehen war, meinte Valerius, das Flüstern der Vergangenheit zu hören – ein Raunen, das in den Ritzen der Häuserwände wohnte.
Er wusste, er war nicht wie ein gewöhnlicher Jäger unterwegs. Seine Beute hatte kein Fell, kein Herz, das im Takt der Angst raste. Sie hatte Geduld, Macht – und den sadistischen Willen, ihn in ihrem eigenen Spiel ersticken zu lassen. Rumanja.
Die Schattenhändler
Sein Weg führte ihn immer tiefer in den Bauch der Stadt: zu Orten, die kein Reiseführer jemals erwähnen würde. Einen davon nannte man La Soute. Ein Gewölbekeller, kaum größer als eine Pferdebox, in dessen stickiger Luft eine ganze Gesellschaft von Schattenhändlern hockte. Männer und Frauen mit Gesichtern, die mehr Falten als Haut besaßen, mit Händen, die vom Feilschen ebenso abgenutzt waren wie von Dingen, über die man nicht sprach.
„Rumanja…“ Das Wort kam zögerlich von einem Alten, dessen Augen tiefschwarz waren, ohne jegliche Spiegelung. „Sie hat keine Armee. Sie hat einen Schwarm. Er fliegt in Schwärmen… klein, verteilt, unsichtbar. Keiner sieht den ganzen Schwarm, bis es zu spät ist.“ Sein Atem roch nach kaltem Kaffee und etwas Eisenhaltigem. „Und ihre Leute?“, fragte Valerius. „Keine Leute. Schatten.“ Ein Lächeln, das weder Freude noch Wärme kannte, blitzte über sein Gesicht. „Sie jagen. Sammeln. Töten. Und dann… verschwinden sie, wie Rauch durch ein Schlüsselloch.“
Bruchstücke der Wahrheit
Von jedem Gespräch nahm Valerius nur Fetzen mit, aber die Fetzen waren scharf wie Glassplitter. Ein buckliger Informant mit einem vernarbten Auge flüsterte: „Sie markiert ihre Beute. Nicht mit Zeichen, die du sehen kannst. Du fühlst es. Ein Brennen im Hinterkopf, ein Kältefilm über dem Herz. Und wenn du es fühlst… dann ist sie längst hier.“ Eine Frau mit rissigen Lippen berichtete: „Manchmal verschwinden ganze Häuserzeilen in der Nacht. Am Morgen sind sie noch da – aber die Menschen darin sind… ausgetauscht.“
Je mehr Hinweise er sammelte, desto klarer wurde das Bild: Die Stadt selbst war ihr Verbündeter. Sie nutzte Paris wie einen Körper, und die Schatten waren ihre Adern.
Orte der Dunkelheit
Valerius begann, die Treffpunkte ihrer Gefolgschaft zu kartieren:
• Verfallene Keller im Quartier Saint-Antoine, in denen das Wasser der Seine tropfend durch das Mauerwerk sickerte, und wo in den Pfützen Schlieren schwärzlichen Öls trieben.
• Eine verlassene Glasfabrik in Saint-Denis, deren geborstene Fenster wie zersplitterte Augen wirkten und in deren Hallen man nachts ein fernes, unheimliches Summen hörte.
• Ein Theater im 9. Arrondissement, dessen Bühne mit einem halben Dutzend alter Spiegel bedeckt war – und bei dem jede Spiegelung leicht versetzt wirkte, als hätte das Spiegelbild ein Eigenleben.
Diese Orte rochen nach Moder, Staub und dem kaum wahrnehmbaren Hauch von Blut, das längst getrocknet war – der Geruch einer Gewalt, die geduldig auf Wiederholung wartete.
Das Spinnennetz
Er sah das Netz vor sich, unsichtbare Fäden, die sich kreuzten und verdichteten, je näher er ihrem Zentrum kam. Jeder neue Informant spannte einen weiteren Faden, und Valerius war sich zunehmend bewusst, dass er selbst im Netz hing – unfähig, sich zurückzuziehen.
Er begann, es körperlich zu spüren: ein leichtes Prickeln auf der Haut, das mit jeder Nacht zunahm, wie statische Ladung vor einem Gewitter. Es war, als würde etwas Altes – älter als Rumanja, älter als alles, was er kannte – unter den Straßen schlafen. Etwas, das bei jedem seiner Schritte den Kopf hob.
Die unausgesprochene Warnung
In einer besonders engen Gasse, deren Wände so nah beieinanderstanden, dass man den Himmel nur als schmalen, schwarzen Spalt sehen konnte, packte ihn ein Mann am Arm. „Such nicht weiter“, zischte er, und Valerius roch seinen Atem – stechend, vergoren. „Sie weiß, dass du die Fäden berührst. Und die Spinne, mein Freund, kommt nicht zu dir, um zu reden.“ „Ich will, dass sie kommt“, erwiderte Valerius. Der Mann lachte trocken. „Dann freu dich – denn sie ist schon hier.“
Die letzte Spur
Diese Worte begleiteten ihn die nächsten Tage wie ein zweites Herzschlagen. Und eines Nachts, als der Regen wieder einsetzte und die Stadt wie in Silber getaucht war, fand er sie: Ein Keller in der Rue de Charenton, schwer verriegelt, doch mit einer Spur aus dunklen Tropfen, die von der Tür fortführten – nicht in, sondern aus der Dunkelheit heraus.
Er wusste: Dies war der letzte Faden, den er greifen musste. Danach gab es nur noch eines – die Begegnung.
Valerius stand still, der Atem dampfte in der kalten Luft, während hinter den Mauern ein kaum hörbares, rhythmisches Klopfen begann. Nicht laut. Aber gleichmäßig. Wie das Herz eines Tieres, das tief in seinem Bau schlief – und das nun begann, aufzuwachen.
Kapitel 19: Das Echo der Vergangenheit
Die Legende war ein Knoten aus Geschichten, Gerüchten und halber Wahrheit, der sich seit Jahrhunderten im Untergrund von Paris zusammenzog. Sie sprach von einem Ort, der so tief verborgen lag, dass selbst die Ratten dort nicht freiwillig verweilten. Ein Schlund, in dem die Luft nie frisch war, sondern alt, dick – schwanger mit Erinnerungen, die man besser begrub. Manche nannten ihn Sanctuaire du Sang. Für Valerius war er zu diesem Zeitpunkt nur ein weiteres Teil des Netzes, das sich um ihn legte.
In einem Hinterzimmer eines antiken Buchladens, zwischen Regalen, die unter vergilbten Zeitungen, zerfallenden Bänden und handgeschriebenen Notizen ächzten, fand er Hinweise. Dort, wo der Staub nicht nur ein Jahr alt war, sondern Generationen getragen hatte. Der Ladenbesitzer, ein Mann mit lederner Haut und einer Stimme, die wie trockene Blätter raschelte, hatte nichts gesagt, als Valerius die Mappe an sich nahm. Doch seine Augen folgten ihm – wissend.
Abstieg ins Erdinnere
Die Katakomben nahmen Valerius auf wie ein nasses Maul. Das Licht seiner Lampe zerschnitt die Schwärze, aber nie weit genug. Die Gänge drängten sich enger, der Boden war uneben, übersät mit Schutt, winzigen Knochenfragmenten und Glasstücken, die wie eingefrorene Tropfen Blut wirkten. Der Geruch – eine Mischung aus kaltem Stein, Moder und diesem anderen Ton, der metallisch auf der Zunge lag – kroch in seine Kleidung.
Er blieb an einer Wand stehen, die mit uralten Markierungen übersät war. Fingerlange Kratzer, die im Halblicht wie runenartige Schrift wirkten. „Das ist sie also, die alte Kaiserin…“ flüsterte eine Stimme neben ihm. Valerius drehte sich scharf um, sah nur eine hagere Frau in einem schmutzigen Mantel. Ihre Augen waren groß, als hätte sie seit Tagen nicht geschlafen. „Rumanja?“, fragte er. „Nein… nicht direkt. Aber ihr Name wird hier geflüstert wie ein Gebet.“ Er wollte mehr wissen, doch sie war schon in den Schatten zurückgesunken, und das Echo ihrer Schritte verlor sich zwischen den Steinen.
Der verborgene Eingang
Schließlich stand er vor dem Grabmal – eine verkantete Struktur aus schwarzem Kalkstein, überwuchert von Flechten, als hätte die Natur versucht, es endgültig zu verschlucken. Eine Platte war lose, und als Valerius sie zur Seite schob, floss kalte Luft heraus, feucht und süßlich. Er duckte sich, schob den Körper durch die Öffnung und stand nun in einem Gang, dessen Wände sich anfühlten, als würden sie atmen. In der Ferne etwas wie Flüstern, nicht laut genug, um Worte zu erkennen, aber mit dieser tonlosen Qualität, die direkt ins Mark kroch.
Die Halle des Throns
Der Hauptraum war kein Raum, sondern eine Wunde. Die Wände waren bedeckt mit Symbolen, in den Stein geschnitten und mit einer Substanz gefüllt, die im matten Licht stumpf glänzte. Zwischen den Symbolen bewegte sich etwas – Schatten, die zu groß für die Kerzenflamme waren und sich dennoch mit ihr bewegten.
Und dann der Thron. Gefertigt aus gebleichten Knochen, ineinander verhakt und verbunden mit rostigen Eisenschellen. An den Gelenken der Knochen hingen dünne Fäden vertrockneter Sehnen, so fein wie Spinnweben. Rumanja saß darauf, als wäre sie schon immer hier gewesen. Die Haut so blass, dass selbst das grüne Schimmern des Amuletts in Valerius’ Hand darauf tänzelte wie Gift. Ihre Haare, schwarz wie verbrannte Erde, klebten in Strähnen an ihren Wangen.
Dialog des Schreckens
„Du bist also gekommen, mein kleiner Jäger…“ Die Stimme war kaum mehr als ein Atem, trocken und doch warm, wie von weit her. „Ich habe dich erwartet.“ „Dann weißt du, was ich hier will.“ „Oh ja.“ Ein Lächeln, das nichts von Freude wusste, breitete sich auf ihrem Gesicht aus. „Du willst mich fangen wie ein Tier. Aber sag mir – bist du dir sicher, dass du nicht längst in meinem Käfig sitzt?“
Hinter ihr, im Halbdunkel, bewegten sich ihre Schattenwesen: verwaschene Umrisse, mal in Menschengestalt, mal formlos, als wären sie Rauch, der sich an das Mauerwerk krallt. Einer von ihnen flüsterte etwas, eine Stimme, die wie der Riss eines Messerblatts klang: „Er bringt das Licht.“ Rumanjas Blick wanderte zu dem Amulett in Valerius’ Hand. „Ah. Das also. Es schreit, weißt du. Nach mir.“
Das Echo
Das Flüstern in den Mauern war jetzt laut. Valerius erkannte einzelne Wortfetzen: Namen, Schreie, Gebete. Er spürte sie – die Geister derer, die hier geopfert worden waren. Sie klebten an der Luft, krochen über seine Haut wie kalte Finger. „Sie singen für mich“, sagte Rumanja leise. „Und bald wirst du mitsingen.“
Das Amulett pochte in seiner Hand, jeder Schlag synchron mit seinem Herz. Das blasse, giftige Grün wurde intensiver, und die Schatten in den Nischen wanden sich wie Tiere, die den Käfig nicht ertragen konnten.
Schwebe zwischen Jetzt und Damals
Die Grenzen lösten sich auf. Er sah Fetzen – Szenen wie alte Fotografien, die überbelichtet und doch zu scharf waren: Ein Kreis aus Kapuzenfiguren um einen Steinblock… Ein Schrei, abrupt abgeschnitten… Blut, das wie Tinte in Rillen lief… Und Rumanja, unverändert seit damals, ihr Blick durch die Jahrhunderte hindurch auf ihn gerichtet.
Er wusste, er stand am Rand einer Schwelle, und dass ein Schritt zu viel ihn entweder retten – oder auslöschen würde. Die Finsternis schien ihn zu umarmen, nicht sanft, sondern besitzergreifend. Und hinter Rumanjas Lächeln lauerte die Gewissheit, dass hier unten niemand schrie, ohne dass es Teil des Liedes wurde.
Das eigentliche Grauen, spürte er, war nicht, dass sie ihn töten konnte. Es war, dass sie ihn behalten könnte.
Kapitel 20: Der Sturm bricht los
Über den Katakomben ballte sich der Himmel zu einer einzigen, pulsierenden Masse aus Finsternis. Kein Mond, keine Sterne – nur eine schwarze Haut, unter der sich Blitze wie zuckende Nervenstränge bewegten. Der Wind heulte durch die Ritzen der verlassenen Mauerreste, und jeder Stoß klang wie das langgezogene Stöhnen eines Wesens, das an seinem letzten Atemzug erstickte.
Dann brach der Sturm los.
Der erste Donnerschlag ließ selbst den Stein unter Valerius’ Füßen erzittern. Regen peitschte über das Kopfsteinpflaster der Straßen weit oben, drang in Ritzen und Tropfsteine und fand schließlich seinen Weg herab, in die modrige Tiefe der Katakomben. Ein beißender Geruch von altem Wasser und zerfallener Erde legte sich auf die Zunge.
Rumanjas Erwachen
Rumanja erhob sich. Ihr Thron – diesmal kein bloßes Knochenrelikt, sondern ein wucherndes Gebilde aus schwarzem Stein und eingearbeiteten Relikten vergangener Opfer – glomm schwach von innen, als ob die Finsternis selbst hier brütete. Jeder Schritt, den sie tat, ließ die Schatten an den Wänden tiefer werden, als zögen sie Kraft aus ihrer Nähe.
„Du bringst Licht in mein Reich, Jäger“, sagte sie, und ihre Stimme war samtig und brüchig zugleich. „Aber Licht brennt nicht ewig.“
Hinter ihr drängte sich ihre Gefolgschaft. Vier, fünf Gestalten – jede mit einem eigenen Gesicht aus Hass. Einer fletschte die Zähne, so nah, dass Valerius den Geruch von altem Blut wahrnahm. Ein anderer riss die Lippen zu einem stillen Grinsen auf, in dem die Eckzähne wie die Spitzen rostiger Nägel wirkten.
Valerius’ Schritt
Er stand am Altar, das Amulett hoch erhoben. Das Licht darin pulsierte wie ein Herzschlag – und der Rhythmus schien sich mit seinem eigenen Herz vereinigen zu wollen. Er roch den feinen, ozonartigen Geruch, der entstand, wenn die Klinge seines Silberschwertes durch die feuchte Luft fuhr.
„Heute endet dein Spiel“, sagte er. „Oder deines“, entgegnete Rumanja.
Mit einem ruckartigen Griff zog er die Ampulle mit dem Sternenstaub hervor, zerschmetterte sie am Steinboden. Der silbrige Nebel quoll heraus, zuerst träge, dann schneller, als hätte er ein Bewusstsein. Er kroch in jede Ritze, umschlang Säulen, und der metallische Geruch mischte sich mit einem uralten, süßlichen Unterton – die Aura von etwas, das nicht sterben konnte.
Wirkung des Staubs
Die Vampire wankten. Einer fiel auf die Knie, krallte sich an den Boden, als würde er unter einer unsichtbaren Last zerbrechen. „Was… hast du… getan?“, stieß er aus. Rumanja sog scharf Luft ein, ihre roten Augen weiteten sich einen Wimpernschlag lang – genug, dass Valerius den Riss in ihrer Maske sah.
„Nur ein wenig… Finsternis zurück in die Sterne geschickt“, sagte er, mehr zu sich selbst als zu ihr.
Kampf der Worte – und der Körper
„Du denkst, das verzögert mich?“ Rumanja trat näher, ihre Stimme kratzte jetzt wie ein rostiger Schlüssel im Schloss. „Das Herz der Leere schlägt bereits… und es schlägt für mich.“
„Dann zwing mich, es dir zu entreißen.“
Sie fauchte, ein Laut, halb Tier, halb etwas weit Älteres, und stürmte vor. Valerius wich aus, Stahl blitzte, der Klang seiner Klinge prallte von ihren Klauen ab – Funken sprühten, als wäre Stein auf Stein geschlagen.
Der Sturm in den Mauern
Draußen explodierte ein weiterer Blitz, und das Licht drang für Sekundenbruchteile durch die Ritzen der Katakombendecke. Im flackernden Aufleuchten sah Valerius das ganze Ausmaß der Halle: die Wände mit eingeritzten Zeichen, die im Blitzlicht glimmten, als wären sie aus glühender Kohle, und Schatten, die nicht verschwanden, selbst wenn das Licht direkt auf sie fiel.
Der Boden begann zu beben. Kleine Steinsplitter lösten sich von der Decke, fielen wie kalter Hagel auf ihre Schultern.
Die Entscheidung naht
„Öffne es“, zischte Rumanja, ihr Gesicht nun kaum mehr als eine Maske aus Hass. „Öffne das Herz – oder ich öffne dich.“
Valerius’ Hände waren feucht, nicht nur vom Regenwasser, das von oben sickerte, sondern vom Schweiß eines Mannes, der wusste, dass kein zweiter Versuch kommen würde. Das Amulett in seiner Hand wurde heißer, pulsierte nun schmerzhaft – als dränge es ihn zu handeln.
Er sah in ihre Augen. Dort war keine Spur von Mitleid, nur ein Mahlstrom aus uralter Macht. „Wenn ich es öffne…“, sagte er leise, „wird keiner von uns zurückkehren.“
Ein kurzes, dunkles Lächeln glitt über ihre Lippen. „Vielleicht ist das der einzige Weg, wirklich zu leben.“
Das Chaos explodiert
Ein Donnerschlag – so nah, dass Staub aus den Mauerritzen stob – mischte sich mit einem Kreischen, das weder ganz menschlich noch ganz tierisch war. Die Schatten an den Wänden lösten sich, krochen über den Boden, schlangen sich um Valerius’ Beine. Er spürte, wie sie zogen, wie kalte Hände ihn in die Tiefe reißen wollten.
Doch sein Griff um das Amulett festigte sich. Er wusste: Der nächste Atemzug würde über beider Schicksal entscheiden.
Kapitel 21: Die Entscheidung in Paris
Der Stein hinter Valerius lebte. Nicht im biologischen Sinn, sondern in jenem alten, flüsternden Rhythmus, den Häuser und Tunnel annehmen, wenn sie zu lange Zeugen von zu viel geworden sind. Die Katakomben atmeten im Takt des Amuletts. Jeder Puls traf ihn durch die Rüstung, schlug an seine Rippen, antwortete wie ein doppelter Herzschlag in einem Körper, der nur einen haben sollte.
Rumanjas Krallen steckten noch in Metall und Fleisch, als hätten sie Anrecht auf beides. Warmes Blut kroch unter den Platten hervor und zeichnete dunkle Linien, die ihm in den Hosenbund sickerten. Ihre Stirn war dicht vor seiner, so nah, dass er die feinen, kaum sichtbaren Risse in der irisierenden Oberfläche ihrer Augen sah — als hätte etwas viel Größeres versucht, hineinzusehen und nicht alles hineingepasst.
„Hör hin,“ flüsterte sie, und ihr Atem roch nach altem Wein und noch älterem Groll. „Sie kennen deinen Namen. Sie kennen dich besser als du dich selbst.“
Das Amulett antwortete, ohne gefragt worden zu sein. Es glomm, atmete, schickte eine Welle durchs Gestein, die Staubkörner wie Sternbilder aufsteigen ließ. Stimmen kratzten an den Rändern seines Bewusstseins, als führten Fingernägel aus Eis über eine Tafel aus Nerven.
Öffne uns … Wir warten schon so lange … Lass uns durch …
„Genug,“ stieß Valerius aus und hörte das Zittern in seinem eigenen Ton. „Genug. Ihr wart noch nie geduldig.“
„Geduld ist eine Krankheit der Lebenden,“ sagte Rumanja. „Wir heilen dich davon.“
Er lachte, und es schmeckte nach Eisen. „Ihr zerreißt, was ihr heilt.“
Ihre Pupillen flackerten — ein kaum merklicher Riss in einer sonst fugenlosen Maske. Es reichte. Valerius riss den Ellenbogen hoch, hörte ein dumpfes Krachen, spürte, wie ihre Finger aus ihm glitten. Er fiel halb nach vorn, fing sich am Schwert, das mit einem hässlichen Ton über den Boden kratzte, und stellte die Klinge zwischen sich und sie.
Die Katakomben grollten. Nicht wie ein Erdbeben, eher wie ein altes Tier, das sich auf eine Seite rollt und alle Steine daran erinnern muss, wer hier unten die Reihenfolge bestimmt. Aus den Schädeln in den Wänden brach ein feiner Staub, der in der Fackelglut zu glimmen begann. Jenseits der leuchtenden Kegel standen Schatten, die nicht von ihnen stammten, und hörten zu.
„Das Portal,“ sagte Rumanja leise. Ihr Blick hing nicht an ihm, sondern hinter ihm, wo die Gänge sich zu einem schwarzen Mund vereinten. „Es ist wach.“
„Es war nie ganz zu,“ gab er zurück. „Paris trägt es wie einen Splitter unter der Haut.“
Sie lächelte ohne Wärme. „Dann zieh ihn endlich heraus.“
Er spürte die Stadt über sich. Nicht konkret — aber als Druck im Ohr, als ferner, flacher Ton, der in alten Rohren wandert. Die Métro, die nachts noch irgendwo fährt; die Seine, die sich an Brückenpfeilern schabt; eine Glocke, die im Schlaf die Stunde verschluckt; das leise Klirren eines Glases in einem Haus, wo jemand allein trinkt. Ein Kind, das im Traum ein Wort sagt, das am Morgen keiner versteht. All das hing über ihm wie eine Decke, die gleichzeitig Schutz und Last war.
„Wenn wir sie vereinen,“ sagte er, „zieht etwas ein, das kein Pflaster hält.“
„Oder es zieht aus,“ hauchte Rumanja. „Und lässt uns mit einer Welt zurück, die nicht mehr an Türen glaubt.“
„Du redest wie ein Priester, der seine Kirche verbrennen will, um endlich die Sterne zu sehen.“
„Du redest wie ein Sohn, der seinen Amboss für eine Mauer hält.“ Ein Funkeln huschte über ihre Züge, das keine Freude war. „Wie oft hast du ihn in Gedanken angerufen? Wie oft hast du dich an seinem Satz festgehalten, damit du nicht entscheiden musstest? Ein Mann ist das, was er tut … Dann tu es, Valerius.“
Er blinzelte, weil der Staub brannte. Das Bild seines Vaters war keine Vision des Amuletts. Es war eine Erinnerung, hart wie geschmiedeter Stahl. Schweiß auf der Stirn, rußige Falten, Augen, die nicht wegsahen. Du bist nicht, was du warst. Du bist, was du jetzt tust.
„Sag mir, was du siehst, wenn du es trägst,“ sagte Valerius.
Rumanja verzog den Mund, als wolle sie spucken und schluckte doch. „Einen Garten. Immer noch. Erde, die nicht nach Blut riecht. Hände, die ausheben, nicht zerreißen. Eine Tür, deren Holz nur Holz ist.“
„Und was sagt es dir, dass du tun sollst?“
„Öffnen,“ antwortete sie ohne Umschweif. „Immer öffnen. Alles öffnen.“
„Dann lügst du wenigstens konsequent,“ sagte er, aber seine Stimme war weicher.
Das Pochen des Amuletts wurde schneller, als hätte es die Geduld verloren, Zuschauer zu sein. Risse flimmerten in den Wänden — feine Linien, die kurz aufglühten und wieder erloschen. Über einem Portalbogen, den sie bisher kaum beachtet hatten, schälten sich Worte aus dem Stein, wie wenn ein alter Name langsam auftaucht, nachdem man über ihn gestrichen hat: Arrête, c’est ici l’empire de la Mort.
„Die Toten waren nie gut im Warnen,“ murmelte Rumanja. „Sie sind zu begeistert von ihren eigenen Geschichten.“
„Und die Lebenden sind zu begeistert von ihren eigenen Ausreden.“ Valerius hob das Schwert leicht, so dass die Klinge die Schrift streifte. „Was also?“
Sie schlug eine Handfläche gegen den Bogen, und die Luft an der Öffnung veränderte sich. Kälter, dichter, als hätte jemand den Raum ausgemessen und festgestellt, dass er zu klein ist für das, was darin wohnt. Aus der Dunkelheit wehte ein Geruch, der an nasses Leder erinnerte, an feuchten Hanf, an die salzige Haut von Matrosen, die zu lange draußen waren. Und weiter hinten etwas Süßliches, das man nicht denken wollte.
„Wir stehen auf einer Naht,“ sagte Rumanja. „Die Stadt ist die Haut. Darunter …“ Sie zuckte mit dem Kopf. „Darunter träumt etwas. Nicht von uns. Von sich.“
„Und die Amulette sind die Nadeln.“
„Nein,“ sagte sie, und jetzt lag in ihrer Stimme etwas Ehrliches. „Sie sind die Hände. Die Nadeln sind wir.“
Valerius senkte das Schwert. „Dann nähst du mit mir. Meinen Stich, nicht deinen.“
„Du willst schließen?“
„Ich will, dass Paris heute Morgen aufwacht und nicht weiß, wie knapp es war.“
Sie sah ihn lange an. In den Schächten knackte ein Stein, als wolle er anklopfen. Zwischen den Schädeln raschelte etwas, das eine Ratte hätte sein können, wenn Ratten nicht wüssten, wann man sich wegduckt. „Wenn du schließt,“ sagte sie schließlich, „wird es sich wehren. Es wird dir zeigen, was du beerdigt hast, und es wird fragen, ob du Blumen mitgebracht hast.“
„Ich bringe ein Schwert.“ Er steckte die Spitze in den Boden und lehnte sich kurz dagegen, als müsse er sich an etwas erinnern, das Körper hat. „Und ein Satz von meinem Vater.“
„Das reicht manchmal,“ sagte sie fast liebevoll und hasste sich dafür in der nächsten Sekunde. „Gib mir die Regeln.“
„Du nimmst deine Hände von meinem Blut. Du bleibst hinter mir. Du rührst nichts an, bevor ich es tue. Und wenn es anhebt, wenn der Riss atmet, dann fällst du nicht in ihn, auch wenn er dir den Garten verspricht.“
„Und wenn er dir deinen Vater verspricht?“ Ihre Augen verengten sich.
„Dann halte ich mich an den Sohn, der ich bin.“ Er hob die freie Hand und zog, ohne den Blick abzuwenden, den Lederbeutel aus der Innenseite seiner Rüstung. Darin, eingewickelt in Tuch, lag sein Amulett. Das Herz der Schatten. Es fühlte sich an, als hätte man Nacht in etwas gegossen, das zu klein dafür war. Die Runen schimmerten fahl, als hätten sie seit Tagen versucht, durch Stoff zu sprechen.
Rumanja legte zwei Finger an ihr eigenes, das Herz der Leere. Es antwortete, als erkenne es ein Echo, das zu nahe klang. Der Raum zwischen ihnen wurde enger, obwohl sie stillstanden. Zwei Magneten, die sich nicht schämten, dass sie wollten.
„Langsam,“ sagte Valerius.
„Ich bin müde vom Langsam,“ gab sie zurück. „Aber gut.“
Die Fackeln flackerten, so plötzlich, als hätte jemand ihnen die Luft abgedreht. Für einen Moment war nur die phosphoreszierende Schrift über dem Bogen zu sehen und das schmutzige Weiß der Schädelreihen. Dann schlugen die Flammen wieder auf, wütender, und warfen ihre Gesichter in harte Geometrien.
„Hörst du das?“ fragte Rumanja.
Er horchte. Jenseits des Grollens, jenseits des Pochen, jenseits der Ratten und des Feuchtigkeitsklackerns der Tropfen kam ein anderer Ton: ein dünnes, schnelles Läuten, als hätte man ganz weit oben eine Tasse gegen eine Untertasse geschoben. Paris, dachte er. Jemand rührt Zucker in Kaffee; jemand fällt ein Glas; jemand sagt ein „Merde“ so leise, dass es nur die Bohnen hören. Und unter all dem: das lange, tiefe, geduldige Summen der Stadt, die sich nicht gern in ihre Geheimnisse schauen lässt.
„Ich höre sie,“ sagte er.
„Dann beeilen wir uns,“ sagte sie.
Er trat an den Bogen. Die Kälte füllte seine Nase wie Wasser. Er hob sein Amulett auf Augenhöhe. Es pulsierte. Einmal. Zweimal. Dreimal. Bei jedem Schlag liefen feine Linien über den Stein, als würden unterirdische Kapillaren kurz beleuchtet, blasse Anatomie einer Stadt, die zu viele Herzen hat.
„Valerius,“ sagte eine Stimme hinter der Stirn, und es war die Stimme des Mädchens mit den dunklen Zöpfen, ohne Anklage, ohne Tränen. „Klopfst du an?“
„Ich gehe nicht hinein,“ sagte er. „Ich nagle zu.“
„Das sagst du immer,“ kicherte eine andere Stimme — seine Mutter, an einem Sommerabend, an dem die Luft nach Pflaumen roch. „Und doch steht die Tür am nächsten Morgen offen.“
„Es reicht,“ knurrte er und spürte, wie seine Finger weiß wurden um das Amulett. „Ich höre euch. Ich öffne nicht.“
Rumanja, die ihn beobachtet hatte, nickte kaum merklich. „Lauter,“ sagte sie. „Du musst lauter sein als das, was in dir schreit.“
„Öffne uns …“ Das Flüstern kam nun durch den Bogen selbst, ohne Umweg, als hätte jemand den Mund an den Spalt gelegt. „Wir sind keine Fremden. Wir sind dein anderer Atem.“
„Du bist Rauch,“ sagte er leise. „Ich bin Lunge.“
Er hob das Amulett höher und zog es zum Bogen. Sofort setzten die Stimmen über, wurden zu Wind in seinen Ohren. Hinter ihm setzte Rumanja ebenfalls ihr Amulett an — nicht berührend, nicht verbindend, aber nah genug, dass die Luft zwischen ihnen zu knistern begann.
„Nicht zu nah,“ warnte er.
„Wie du befiehlst,“ hauchte sie, und der Spott war nur zur Hälfte gespielt.
Der Stein vibrierte unter dem Druck beider Herzen. Runen auf beiden Amuletten begannen, gegeneinander zu laufen, als suchten sie im andern den vergessenen Satzteil. Es roch nach Ozon, nach verbranntem Staub, nach Kindertagen in Gewittern, in denen man dachte, der Himmel reiße jetzt wirklich auf.
„Wenn ich dir jetzt den Garten gebe,“ raunte etwas jenseits des Spalts, „legst du das Schwert weg?“
„Wenn ich dir jetzt den Amboss gebe,“ raunte eine andere, „hörst du auf zu schmieden?“
Valerius legte die Klinge flach an den Stein, die Spitze nach unten, den Rücken an die Schrift. „Ein Mann ist das, was er tut,“ sagte er klar, damit die Knochen es hören konnten. „Und heute bin ich der, der bindet.“
„Dann binde,“ sagte Rumanja, und ihre Stimme hatte diese unheimliche, ungewollte Wärme. „Aber tu es schnell.“
Er neigte sein Amulett im Winkel, den die brüchigen Folianten beschrieben hatten: nicht frontal, nicht diagonal, sondern so, dass das Licht rückwärts in den Spalt fiel, als sei es Wasser, das man in eine Kehle gießt. Das Portal atmete ein. Die Schädel schienen einen Moment lang zu lächeln — man hätte schwören können, dass sie lächeln wollten —, dann sprang eine kalte, blaue Zunge heraus und leckte über seine Knöchel.
Er hielt stand. Die Stimmen wurden dünner. Das Pochen richtete sich an seinem eigenen Takt aus, und plötzlich war da Stille — jene seltsame, gespannte, die nicht leer ist, sondern wie die Sekunde nach einem Geständnis.
„Es hält,“ flüsterte Rumanja. Ihre Finger lagen an ihrem Amulett, als wolle sie es beruhigen. „Es hält.“
„Noch nicht,“ sagte Valerius, der die Spannung spürte wie ein Schmied, der weiß, dass die Klinge im Wasser noch brechen kann.
Eine neue Vibration lief durch den Stein, tiefer, tückischer. Etwas in der Ferne, im Labyrinth der Gänge, antwortete. Ein dumpfes, langsames, ernüchternd regelmäßiges Klopfen, als würde ein Riese seine Stirn gegen eine Wand legen und zählen. Eins. Zwei. Drei.
„Wir sind nicht allein,“ sagte Rumanja, und jetzt schimmerten ihre Zähne. „Die Alten bewegen sich.“
„Lass sie,“ antwortete Valerius. „Heute tanzen wir.“
Er zog sein Amulett ein Stück zurück, nur einen Atem lang, um es im gleichen Schwung wieder an denselben Punkt zu setzen. Das Licht, das aufflammte, war nicht gierig, sondern fest. Es fädelte sich in die feinen Risse, machte Nähte aus Glühen, zog die Kanten des Spalts zusammen wie zitternde Lippen. Die Luft knirschte. Der Stein stöhnte. Und der Bogen begann, nicht zu schließen, aber zu erstarren — die Offenheit zu einem schmalen, widerspenstigen Schlitz.
„Paris,“ hauchte Rumanja. „Hörst du es?“
Oben, weit oben, setzte eine Glocke an und brach wieder ab. Ein Hund winselte. Ein Mann sagte „Non, non“, ohne zu wissen, zu wem. Die Seine drehte ein Auge und tat so, als wäre nichts gewesen.
„Noch ein Zug,“ sagte Valerius. „Noch eins.“
Er hob sein Amulett ein winziges Stück höher — und in diesem Augenblick, in dieser haarfeinen, menschlichen Unvollkommenheit des Zögerns, in diesem Zittern, das weder Schuld noch Tugend war, sondern schlicht: Blut — in genau diesem Spalt zwischen Wille und Muskel riss die Dunkelheit die Initiative an sich.
Die beiden Amulette, die sich bisher nur umkreist hatten wie Wölfe an einer Grenze, sprangen aufeinander zu. Nicht vollständig, nicht wie in einer Umarmung, die man will, sondern wie in einem Reflex, der stärker ist als Absicht. Ein Funke fuhr, trocken, hell. Die Luft schnappte. Der Bogen gab ein Geräusch von sich, als hätte er Hunderte Jahre lang nicht husten dürfen und täte es nun endlich.
„Valerius!“ Rumanja riss ihr Amulett zurück, aber die Fäden aus Licht hingen zwischen beiden wie Speichelfäden zwischen Zähnen. „Nicht jetzt—“
„Zu spät,“ sagte eine Stimme, die nicht ihre war und nicht seine und doch aus ihren beiden Mündern kam.
Der Stein vibrierte neu, heller, schärfer. Zwischen den Herzen der Schatten und der Leere hing nun etwas Drittes, etwas, das man nur sah, wenn man nicht direkt hinsah: ein dünner, singender Draht, der — wenn man ihn anstarrte — zu vielen Drähten wurde, zu einem Netz, zu einer Harfe.
Jemand — etwas — zupfte eine Saite.
Die Katakomben antworteten mit einem Laut, der Musik sein wollte und Krieg war.
Valerius’ Kiefer mahlten. „Nicht brechen,“ sagte er zu sich selbst, zu seinem Arm, zum Stein, zu Paris. „Nicht jetzt.“
Rumanja beugte sich vor, ihre Stimme war ein Messer, das man sanft unter eine Kehle legt. „Entscheide, Sohn des Schmieds. Hältst du, oder lässt du zusammenprallen?“
Er sah das Mädchen mit den dunklen Zöpfen am Rand seines Blicks stehen. Kein Vorwurf, nur Anwesenheit. Er sah den Amboss. Eine Hand darauf. Seine, nicht seines Vaters. Darüber das Schwert, das er getragen, das er gewetzt, das er geführt hatte — für, gegen, zuletzt: trotz.
„Ich halte,“ sagte er. „Ich halte, bis es mich frisst. Und wenn es mich frisst, beiße ich.“
„Dann beiß gut,“ sagte Rumanja.
Die Fäden sangen auf. Das Netz spannte sich. Über ihnen, unter ihnen, in ihnen. Valerius’ Hand krampfte um das Herz der Schatten; Rumanjas Finger krampften um das Herz der Leere. Zwei Räuber, die begriffen, dass die Beute sie längst im Magen hatte.
Das Portal atmete ein. Paris hielt den Atem an.
Und in genau dieser Atemstillstand-Sekunde — in der die Welt so dünn wurde wie Papier — machte etwas, das nicht hierher gehörte, die kleinste aller Bewegungen.
Das Licht kniff die Augen zusammen.
Die Dunkelheit lächelte.
Cliffhanger sind selten höflich. Dieser war es auch nicht. Er setzte sich wie ein kalter Finger an die Wirbelsäule beider — und drückte.
Die Falle begann zu schließen.
Kapitel 22: Die Falle schnappt zu – Ein erzwungenes Portal
Die Katakombe hielt die Luft an. Nicht nur der Gang. Nicht nur die Nische, in der die Schädel wie porzellanene Tassen aufgestapelt lagen. Alles, der ganze unterirdische Bauch der Stadt, schien für einen schmerzhaften Pulsschlag lang stillzustehen, bevor die Gewalt kam.
Rumanja prallte auf Valerius, und der Aufprall hatte etwas Unverschämtes: zu nah, zu schnell, zu sicher. Ihre Hände, eher Waffen als Glieder, fanden Ritzen in seiner Rüstung, gruben sich hinein, rissen Metall auf, als sei es nasses Leder. Ihre Augen – zwei Feuer, die nicht wärmen konnten – standen so dicht vor seinen, dass er die dünnen Haarrisse in den Irisringen sah, als wäre etwas an ihnen zu groß geworden.
„Du bist langsam geworden,“ zischte sie. „Die Jahre haben dich weich gemacht.“
„Weich reicht, um dich zu brechen,“ presste er hervor, und Blut schmeckte plötzlich wie alte Münzen.
Sie drückte ihn gegen den bröselnden Stein. Der Kalk gab knirschend nach; eine Kaskade von Staub rieselte an seinem Nacken hinab. Ein einzelner Schädel löste sich oben aus einer scheinbar ewigen Ordnung, rollte auf den Boden und blieb neben seiner Ferse liegen, als wolle er zuhören.
Ein einziger Augenblick trennte ihn vom Untergang. Dann griff die Übung ein, die mit tausend einsamen Nächten in ihn hineingedrillt worden war wie eine zweite Natur. Seine Rechte schnappte an den Gürtel, glitt unter eine Schicht Leder, fand, was immer dort gewartet hatte: das Herz der Schatten.
Es war kälter, als er sich erinnerte. Kälte, die nicht auf der Haut blieb, sondern sich in Knochenhöhlen legte. Die Runen darauf – feine Kerben, die einmal Hände gemacht hatten, die es nicht mehr gab – vibrierten, als die Luft im Gang plötzlich dichter wurde.
„Nein,“ sagte Rumanja, und in diesem einen Wort lag mehr als Widerstand: Es lag Erkenntnis. „Nicht das.“
„Doch,“ flüsterte Valerius, und das Flüstern war hart wie Glas, „genau das.“
Er stieß. Ein sauberer, brutaler Stoß, die Faust vor, der Arm durchgezogen, der Körper ein einziges Werkzeug. Das Herz der Schatten traf auf das Herz der Leere an Rumanjas Hals. Zwei kalte Sonnen stießen zusammen.
Der Klang, der sich daraus befreite, war kein Klang, den Menschen sich hätten ausdenken können. Er rollte nicht nur durch die Ohren, sondern knetete Fleisch, stampfte Knochen, vibrierte in alten Nähten, die nie für so etwas gedacht waren. Das Dröhnen kroch in die Wände, und die Wände antworteten. Moos dampfte. In das matte Weiß der Schädel trat ein krankes Leuchten.
„Was hast du getan?“ Rumanjas Stimme war plötzlich klein und sehr weit weg, als spräche sie durch Wasser.
„Ich habe den Atem angehalten,“ sagte Valerius. „Jetzt atmet es für uns.“
Wenn Stein zu Haut wird
Die Symbole erwachten zuerst. Alte, flache Ritzungen, die über Jahrzehnte nur Hintergrund gewesen waren, begannen zu glühen – nicht gleichmäßig, sondern pulsierend, als erinnerten sie sich in Stößen. Gold sprang auf, wurde von Silber überlagert, das Silber floss in ein tiefes Rot, das eher an getrocknetes als an frisches Blut erinnerte. Die Luft bekam ein Gewicht, das nicht aus Sauerstoff bestand.
Feuchtigkeit löste sich aus den Fugen; sie roch nach etwas Vergessenem: Segeltuch, das zu lange im Regen hing; Wolle, die nie ganz trocken wurde; die Zunge eines Tiers, das man nicht kannte. Tropfen fielen wie metronomische Ermahnungen. Irgendwo knirschte eine alte Bohle, und das Geräusch war, als würde jemand in einem Holzsarg umdrehen.
„Halt es fern,“ knurrte Rumanja, doch ihr Körper gehorchte nicht mehr ganz. Ihre Finger krampften auf dem Band ihres Amuletts. Der Blick, der so oft wie ein Messer war, flackerte.
Valerius spürte den Schlag der beiden Herzen – nicht seine, nicht ihre – zwischen seinen Händen. Es war ein Takt, der ihm Befehle geben wollte. Lass los. Halt fest. Schieb. Zieh. Öffne. Schließe. In jeder Silbe lag eine Drohung.
„Ich habe dich gehofft und nie geglaubt,“ murmelte er, und es war unklar, zu wem er sprach.
Das Licht kam, als hätte jemand ein unsichtbares Reservoir geöffnet. Es war kein Schwall Helligkeit, sondern ein Strom, ein Fluss. Azurblau, klar, aber mit einer Tiefe, die Schwindel war. Wo es zuckte, schrien die Schatten – nicht laut, aber endgültig. Sie wurden aufgerollt wie Teppiche, von den Wänden gezerrt, von den Fackeln gelutscht, von den Schädeln gesogen, bis nichts als Luft blieb, die wusste, was sie verloren hatte.
Valerius kniff die Augen zu, doch das half nicht. Hinter den Lidern brannte es weiter, zeichnete Linien in seine Gedanken, als stünde dort jemand mit einem blauen Brandmal.
„Hör auf,“ keuchte Rumanja. Ihre Stimme brach über dem Wort. „Hör—“
„Du wolltest es,“ sagte er, und es klang nicht wie ein Triumph. Eher wie der Satz, den man sagt, wenn die Rechnung kommt.
Der Sog der falschen Sterne
Es begann wie eine Einatmung. Als holte die Katakombe Luft – zu viel Luft – und es gäbe nur noch einen Ort, an dem diese Luft sein dürfte: dort, wo sie beide standen.
Die Kraft fuhr sie an die Füße. Kein Wind, keine Hand; eher eine Richtung, die beschloss, dass sie jetzt nach vorne gehört. Der Boden unter ihnen kippte nicht; die Welt tat es. Zwischen den beiden Amuletten öffnete sich etwas, das kein Loch war und doch alle Eigenschaften eines Lochs hatte: Es zog. Es fraß. Es machte Dinge kleiner, damit sie hindurchpassten.
Farben nahmen ihnen die Sprache. Grün, das metallisch auf der Zunge lag. Violett, das hinter den Augen kratzte. Ein Schwarz, das selbst Laut war – tief, chorisch, als sänge es Namen, die nie ausgesprochen werden durften.
Sternenstaub – die feine Patina aus Jahrhunderten, Abrieb von Knochen, Pulver von Geschichte – hob sich, schwebte auf, freute sich fast, als hätte er lange auf die Einladung gewartet. Er wickelte sich um Rumanja wie Seide, nur dass Seide nicht brennt. Ihre Haut knisterte, dort, wo der Staub lag. Sie riss an ihm, bekam ihn nicht zu fassen, weil er kein Ding war; er war Absicht.
„Lass mich los!“ schrie sie, und das Schreiende daran war keine Drohung. Es war die Angst, die nur kommt, wenn man die Rolle verliert, die man sich selbst gegeben hat.
Valerius stemmte die Stiefel, suchte Risse im Stein, in die er die Kanten drücken konnte. Der Sog zog an seinem Schwert, an seinen Haaren, an allem, was von ihm abstand. Das Blatt in seiner Hand wurde unruhig; es vibrierte, feine Risse krochen aus der Parierstange und glänzten violett. Ein Protest, ein Begreifen: Da, wo wir hingehen, gilt Stahl nicht mehr.
Die Stimmen kamen mit Macht. Nicht aus dem Gang, nicht aus dem Spalt, nicht aus den Amuletten. Aus ihm.
„Valerius…“ Die Stimme seiner Mutter schob sich in seine Ohren wie ein warmer Löffel Suppe. „Du warst immer zu weit fort.“
„Junge.“ Der Vater. Kein Urteil, nur die Feststellung eines Werkzeugs: Der Hammer ist auf dem Boden gefallen. Heb ihn auf.
Und dann das Mädchen mit den dunklen Zöpfen. Kein Vorwurf in ihrem Ton. Nur dieses entsetzliche Angebot: „Komm.“
Er streckte die freie Hand aus, und sie drehte sich im selben Moment zu einer Fratze, als hätte er zu früh gegriffen. Alles löste sich auf, was greifbar schien. Alles wurde Echo.
„Fass ihn nicht an!“ Rumanja schnappte nach seinem Handgelenk, riss zurück, ließ los und schrie auf, als der Staub ihre Finger verbrannte. Ihre Augen weiteten sich, und in ihnen war der blanke, hässliche Kern eines jeden Monsters: Sie wollte nicht sterben.
„Halt dich an mir fest!“ rief Valerius, und es war absurd, aber wahr.
Sie sah ihn an, als hätte er sie geohrfeigt. Dann packte sie die Kante seiner Rüstung, die noch nicht flackerte. Zwei Gegner, die für eine effiziente Sekunde eine Einheit bildeten – nicht aus Loyalität, sondern aus Säure, die dieselbe Wand frisst.
„Wenn wir gehen,“ keuchte sie, „dann nicht als Beute.“
„Nein,“ sagte er. „Als Fehler.“
Das Licht zog an. Der Gang wurde länger und kürzer zugleich. Die Schädel bekamen Gesichter, die keine waren, aber schauen konnten. Das Dröhnen wurde tiefer, so tief, dass es nicht mehr war, sondern wurde.
„Nicht fallenlassen,“ murmelte Valerius sich selbst zu, dem Schwert, der Welt. „Nicht fallen—“
Der letzte Ruck schnappte. Aus der Mitte. Ein Aufblitzen – zu hell, zu heiß, zu endgültig.
Dann: Nichts. Kein Wind. Kein Geräusch. Kein Gefühl.
Was bleibt, wenn alles fort ist
Die Katakomben standen da, als hätten sie gerade einen schlechten Traum gehabt. Die Fackeln flackerten, aber sie warfen wieder normal aussehende Schatten. Der Staub sank herab, so langsam, als wolle er es nicht zugeben.
Die Wände – eben noch leuchtend – lagen wieder kalt und tot in ihrem Kalk. Ein dünner Geruch nach Ozon blieb, als Erinnerung daran, dass Luft auch anders kann. Das Arrête an der Schwelle leuchtete noch einen Herzschlag nach, dann war es wieder nur Schrift.
Nur eines war anders: Niemand stand mehr da. Nicht der Mann mit dem Schwert. Nicht die Frau mit den Krallen. Luft füllte die Form, die ihre Körper hinterlassen hatten, und tat, als wäre sie schon immer hier gewesen.
Ein Tropfen löste sich aus einer schadhaften Stelle in der Decke und fiel. Er machte ein lauteres Geräusch, als er hätte machen dürfen. Ein Geräusch, das sich merkte, dass gerade etwas sehr Unerlaubtes geschehen war.
Paris hört zu
Oben tat Paris, was Städte tun, wenn das Unerlaubte beschließt, höflich zu sein: Es kündigte sich an.
Am Boulevard Saint‑Germain klirrten Weingläser in Vitrinen. Nicht, weil sie berührt wurden, sondern weil eine unausgesprochene Frage an ihnen vorbeiging. Die Besitzerin der Brasserie drehte ihren Kopf so schnell, dass ihr Nacken knackte, und sagte „Hein?“, obwohl niemand sie angesprochen hatte.
Im Schatten der Treppen von Montmartre stellte eine Katze ihr Fell auf, so gleichmäßig, als würde es ihr ein Mechanismus befehlen. Sie blickte in eine Gasse, in der nichts war, und begann zu knurren – ein feines, hochfrequentes Geräusch, das selbst die Ratten kurz höflich machte.
Auf dem Pont Neuf blieb ein junger Mann stehen, mitten in einem Lachen, das in der Luft stehen blieb wie ein Ballon. Das Wasser der Seine hob und senkte sich in gleichmäßigen Wellen, obwohl kein Wind ging. Eine Frau auf dem Rad trug einen Korb mit Baguettes; sie spürte plötzlich, dass das Brot schwerer wurde. Sie bremste, ohne zu wissen, warum.
Dann kam es. Das Licht.
Nicht aus Lampen, nicht aus Fenstern. Aus dem Stein. Ein azurblauer Schimmer kroch durch Risse im Pflaster, schoss an Hauswänden empor, zitterte über Dachziegeln und lief wie Wasser in jede Rille. Es war, als hätte die Stadt die Haut gewechselt und zeige nun inneres Leuchten.
Auf dem Vorplatz von Notre‑Dame hoben Touristen die Telefone, und in zwei Bildern war etwas zu sehen, das man wegwischen wollte: Ein Wasserspeier wandte für einen Herzschlag lang den Kopf. Seine Zähne waren zu viele. Sein Blick zu lebendig. In der dritten Aufnahme sah er wieder dorthin, wo er immer hinsah.
Ein alter Mann am Ufer ließ seine Pfeife fallen – plopp –, weil am Himmel für einen Augenblick etwas aufging: Sterne, zu hell, zu nah. Sie standen nicht dort, wo sie hingehörten, und doch waren sie genau richtig. Er machte ein Kreuz und fühlte sich dabei lächerlich und sicher zugleich.
Kinder in den oberen Etagen richteten sich gleichzeitig in den Betten auf und begannen zu weinen. Nicht, weil sie Angst hatten. Weil die Luft schmeckte, als hätten im Haus fremde Leute gesprochen. Hunde setzten sich hin, legten die Ohren an und jaulten. Glocken begannen zu läuten, dünn und dann stark, ohne Hand, ohne Seil. Metall antwortete auf etwas, das kein Mensch gefragt hatte.
Am Place de la Concorde hob sich ein Geräusch aus der Tiefe. Dumpf. Gemessen. Kein Donner. Ein Schritt, der keiner war. Menschen hielten sich die Ohren zu und schauten nach oben, weil „oben“ der Ort ist, an den man schaut, wenn man unten nicht denken will.
„C’est quoi, ça?“ fragte eine Frau, die gerade ihre Einkaufstüten sortierte.
„Rien,“ sagte der Mann neben ihr automatisch, und keiner von beiden glaubte es.
In einem Apartment mit Blick auf die Rue de Rivoli blieb eine Tänzerin in der Haltung stehen, die sie seit Wochen übt, und spürte, wie der Boden unter ihrem Fuß eine Entscheidung traf. Ein Polizist im 11. Arrondissement zog sein Telefon und filmte fünf Sekunden des Lichts, ehe die Kamera sich weigerte, Farben korrekt zu benennen. Ein Chauffeur hielt vor der Oper an und drehte die Musik leiser, als könne Lautstärke das Falsche beleidigen.
Ein Bäcker in der Rue Mouffetard schob gerade ein Blech Croissants in den Ofen. Er stoppte mitten in der Bewegung, weil der Teig eine Sekunde lang aussah, als atme er. Er flüsterte „Pardon“ – wem, wusste er nicht – und schob das Blech dann doch hinein, sehr vorsichtig, als ginge es um etwas anderes als Butter und Mehl.
Eine Nonne in Saint‑Sulpice kniete nieder und merkte, dass ihr Gebet heute schwerer war, aber nicht deshalb, weil es weiter tragen musste. Es war, als legte es sich auf eine andere, sehr alte Schicht aus Worten, die schon da waren.
Auf einem Balkon in Belleville hielt ein Junge eine Taschenlampe in den Mund, um die Hände frei zu haben, und malte mit einem Schraubenzieher Herzchen in das beschlagene Fenster. Als das Licht durch die Ritzen kam, schimmerte sein Herzchen einen Augenblick lang, als sei es ernst gemeint.
Dann zog sich alles zurück.
Nicht wie ein geordneter Rückzug. Eher wie ein Reflex. Das Azur tropfte aus Rissen, floss an Fassaden wieder hinab, versickerte im Pflaster. Die Glocken verstummten, manche mit einem letzten, unentschlossenen Zittern. Die Seine tat so, als wäre sie nie aus dem Takt gewesen. Menschen räusperten sich und taten, als hätten sie das nicht gehört.
Paris atmete wieder.
Das Gewicht der Stille
Nichts war kaputt. Kein Stein lag anders. Keine Mauer fiel. Und doch fühlte die Stadt sich an, als hätte jemand an einer Schraube gedreht, die ein wenig zu groß war, um unbemerkt zu bleiben.
Die, die es gesehen hatten – die Madame mit dem schweren Armreif im Salon am Quai, der Bettler im Schatten der Brücke, die Tänzerin in Rivoli, der Bäcker mit mehligen Händen, der Polizist mit dem schlechten Video – trugen nun ein Bild in sich. Kein Vision, keine Halluzination. Eine Gewissheit, die man nicht erzählen konnte, ohne sich lächerlich zu machen: Die Welt hatte gezittert. Nicht aus Angst. Aus Erinnerung.
Im Untergrund knirschte ein Stein, weil Steine das tun, wenn sie nachdenken. Eine Ratte stoppte vor einer Kreuzung, die sie kannte, und wählte heute einen anderen Weg, ohne Gründe. Ein Tropfen fiel. Er brach auf dem Boden und hinterließ einen winzigen, perfekten Kreis, der länger glänzte als nötig.
Paris war still. Nicht leer. Nicht beruhigt. Still wie vor dem Moment, an dem man endlich zugibt, was ohnehin wahr ist. Still wie vor dem Knacks in der Schale, wenn etwas schlüpfen will.
Und tief unten, dort, wo das Licht zu scharf und die Schatten zu alt geworden waren, war nichts zu sehen. Kein Mantel, kein Blut, kein Haar. Nur Luft, die tat, als sei sie ganz allein.
Valerius und Rumanja waren nicht mehr da.
Das Schweigen legte sich zurück auf die Stadt wie eine Decke, die zu viel weiß. Und irgendwo, jenseits dessen, was Steine tragen sollen, zog etwas die Tür nur einen Spalt zu, nicht mehr. Nur so viel, dass man wieder schlafen konnte. Nur so lange, bis jemand von innen anklopft.
Kapitel 23: Die fremde Dimension
Valerius schlug auf. Der Aufprall trieb ihm die Luft aus den Lungen, ein dumpfer Schlag, der durch Mark und Bein ging. Für einen Augenblick glaubte er, zerbrochen zu sein, jeder Knochen ein Splitter, jedes Gelenk zu Staub zermalmt. Er lag da, keuchend, das Gesicht in einer dünnen Schicht feuchten Schlamms gepresst, der kalt und schmierig an seiner Haut klebte. Ein Geruch von Fäulnis kroch in seine Nase, schwer, erstickend, wie das Innere eines jahrhundertealten Grabes.
Langsam, mühsam, schob er sich hoch. Jeder Muskel schrie. Sein Schwert, noch immer in der Hand, zitterte, als wäre es lebendig, als würde es den Ort spüren, in den sie geraten waren. Er kniete, spuckte Blut aus, und hob schließlich den Kopf.
Was er sah, ließ ihn den Atem anhalten.
Um ihn herum breitete sich eine Ebene aus, endlos, so weit das Auge reichte, und doch schien sie sich unnatürlich nahe anzufühlen, als wäre der Horizont kein Ort in der Ferne, sondern ein Käfig, der sich eng um ihn schloss. Der Boden war feucht, von einer grauen, wabernden Substanz überzogen, die zwischen Schlamm und Fleisch schwankte. Immer wieder stiegen kleine Blasen auf, platzten geräuschlos, und setzten einen Gestank frei, der süßlich und verrottet zugleich war.
Dort ragten Bäume. Oder das, was wie Bäume aussah. Ihre Stämme waren knorrig, schwarz, von einer Substanz durchzogen, die an verkohlte Knochen erinnerte. Die Äste reckten sich nach oben wie Finger, die in einer ewigen, stummen Bitte zum Himmel zeigten. Manche Äste bewegten sich, auch ohne Wind, langsam, schleichend, als suchten sie nach etwas.
Der Himmel selbst war eine Wunde. Violett, durchzogen von Adern, die pulsierten wie lebendig. Zwei Monde hingen dort: einer tiefrot, schwer, als hätte er Blut getrunken, der andere blass und unheilvoll, ein weißes, totenstilles Auge, das ihn ansah – nur ihn. Valerius spürte es: Der Mond sah in ihn hinein, bis in die tiefsten Winkel seiner Seele.
Er schluckte. Der Boden unter seinen Knien vibrierte, schwach, aber stetig, wie ein gigantischer Herzschlag, der unter der Welt pochte.
Und dann hörte er sie.
„Du Narr!“
Rumanja stand nur wenige Meter entfernt. Ihr Körper, sonst eine Quelle unbändiger Kraft, wirkte geschwächt, als hätte die Reise durch das Portal sie zerfressen. Ihre Haut war blasser, die Linien ihres Gesichts härter, ihre einst so geschmeidige Haltung gebrochen. Der Sternenstaub klebte noch an ihr, leuchtete schwach auf ihrer Haut wie Wunden, die nicht heilten.
Ihre Augen jedoch – diese roten, brennenden Augen – funkelten noch immer, voller Hass, voller Hunger.
„Du hast uns in die Zwischenwelt gebracht!“ Ihre Stimme krächzte, heiser, von einer Panik durchzogen, die sie verzweifelt zu verbergen versuchte. „Hier ist deine Macht genauso begrenzt wie meine!“
Valerius sah sie an. In ihrem Ton, in der Art, wie sie die Worte ausstieß, lag etwas, das sie verriet. Ein Zucken in ihrer Stimme, ein Zittern, das sie nicht kontrollieren konnte.
„Lüg weiter“, dachte er. Laut sagte er nichts, nur seine Augen verengten sich, wie ein Messer, das zum Schnitt ansetzt.
Denn er spürte es. Die Welt hier… sie war nicht neutral. Sie war feindlich. Jeder Atemzug war wie Glas in seiner Kehle, die Luft dünn, giftig, ein Flüstern, das ihm sagte, er sei hier fehl am Platz. Doch zugleich fühlte er, dass die Fäden, die Rumanja sonst durch diese Welt spann, gerissen waren. Ihr Einfluss, ihr unerschütterlicher Griff auf die Schatten, war schwach.
Das hier war kein Zufall. Das hier war sein Schlachtfeld.
Valerius richtete sich vollends auf. Sein Körper protestierte, doch er zwang ihn, gerade zu stehen. Das Schwert in seiner Hand vibrierte erneut, summte, als würde es die Dunkelheit herausfordern.
Rumanja lachte plötzlich, ein krächzendes, scharfes Lachen, das den Boden zum Zittern brachte. „Glaubst du wirklich, du könntest hier gewinnen? Dies ist die Welt zwischen den Welten. Hier lebt, was selbst die Dunkelheit fürchtet. Du hast uns beide dem Untergang geweiht.“
Valerius schwieg. Doch in ihm rumorte es. Ein Teil seiner Gedanken war bei Paris, bei den Menschen, die jetzt in Sicherheit wähnten, dass alles überstanden sei. Sie wussten nicht, dass die wahre Entscheidung erst hier fallen würde.
Er ließ den Blick schweifen, suchte nach Bewegungen im Schatten. Und da waren sie. Ganz am Rand seines Blickfeldes, Gestalten. Keine klaren Formen, nur Silhouetten, die sich bewegten, als stünden sie hinter einer hauchdünnen Wand aus Glas. Zu viele Augen. Zu viele Glieder. Flüsternde Stimmen, die er nicht verstand.
Die Welt sah zu.
Ein Zittern ging durch Rumanjas Körper. Sie hatte es ebenfalls gespürt. Die Zwischenwelt war nicht leer. Sie war ein Zuschauerraum, und ihre Bewohner warteten auf das, was nun geschehen würde.
Valerius hob das Schwert, seine Stimme leise, aber schneidend: „Dann sehen wir, wem diese Welt gehört.“
Die Luft spannte sich, knisterte, als hätte sie ein Eigenleben. Der Boden atmete. Der Himmel starrte.
Und die Zwischenwelt begann, ihren Preis zu fordern.
Die Stille zwischen Valerius und Rumanja hielt nur Sekunden. Doch diese Sekunden dehnten sich wie ein Strick, der sich um den Hals zieht.
Dann veränderte sich die Luft.
Zuerst war es nur ein Flüstern, kaum mehr als ein Hauch, der über den grauen Boden kroch. Worte, die keine waren, ein Wispern, das die Haut prickeln ließ, als würde jemand direkt in sein Ohr atmen. Valerius’ Griff um das Schwert wurde fester. Sein Herz hämmerte, doch er zwang sich, die Augen offen zu halten.
Die Schatten am Rand der Ebene wurden dichter. Gestalten lösten sich aus dem violetten Zwielicht: groß, klein, kriechend, schwebend. Keine hatte eine Form, die der Verstand fassen konnte. Manche wirkten wie Kinder, deren Gesichter fehlten, andere wie Tiere, die zu lange im Dunkeln gelebt hatten, sodass ihre Körper sich verzogen, verdreht hatten. Manche hatten Augen – zu viele, flackernd wie Glühwürmchen. Andere hatten Münder, die sich öffneten und schlossen, ohne dass ein Laut herauskam.
Doch sie alle starrten.
Valerius fühlte sich durchbohrt, nackt, ausgezogen bis auf die Seele. Ihre Blicke waren keine Blicke – sie waren Hunger.
Rumanja keuchte, und zum ersten Mal wirkte sie wirklich menschlich. „Sie… sie dürfen nicht näher kommen. Wenn sie den Geruch von Blut wittern, dann—“
Sie verstummte, als hätte sie zu viel verraten. Doch ihre Augen verrieten, dass sie Angst hatte.
Valerius grinste nicht. Er spürte keinen Triumph. Denn das, was sich dort regte, machte auch ihm das Blut kalt.
Eine der Gestalten trat näher. Oder vielmehr: Sie glitt. Kein Geräusch, keine Bewegung der Glieder. Sie war einfach da, näher, als sie eben noch gewesen war. Ein Kopf, der keiner war, schwebte auf der Höhe seines Brustkorbs. Ein Gesicht aus Hautfalten und Löchern, in denen Augen hätten sein können. Es neigte sich, prüfend, neugierig.
Valerius spürte, wie das Schwert in seiner Hand vibrierte, als wollte es von allein losschlagen. Doch er hielt es zurück. Instinkt sagte ihm: Wenn er der Erste war, der die Wesen angriff, würde er sie alle gegen sich aufbringen.
„Sie beobachten uns“, murmelte er, die Worte kaum hörbar.
Rumanja knurrte, aber es klang gepresst, unruhig. „Dann gib ihnen etwas zu sehen.“
Mit einem Zischen stürzte sie vor. Ihre Klauen blitzten, rissen nach seiner Kehle.
Valerius blockte, das Schwert kreischte im Zusammenstoß mit ihren Krallen. Funken stoben, blau, als hätte die Zwischenwelt selbst entschieden, die Klingen zu füttern. Er wirbelte, schlug nach ihr, doch sie wich zurück, ihr Körper noch immer schneller als sein Auge folgen konnte – nur ein wenig langsamer, nur ein wenig geschwächt.
Und ringsum: Bewegung.
Die Wesen waren näher gekommen. Bei jedem Schlag, bei jedem Aufeinandertreffen der beiden Kämpfer rückten sie heran, wie Zuschauer, die an den Rand einer Arena drängten. Manche lachten – ein Laut wie zersplitterndes Glas. Andere weinten, ihre Stimmen hohl, als kämen sie aus dem Boden selbst.
Rumanja schlug erneut, traf Valerius an der Schulter. Er spürte, wie das Fleisch aufriss, warmes Blut quoll hervor. Und sofort – SOFORT – regten sich die Wesen.
Ein Raunen ging durch die Menge. Münder öffneten sich, die keine Kehlen hatten. Zungen leckten über nichts. Ein Wispern, diesmal gierig. Blut…
Valerius stolperte zurück, das Schwert erhoben. Er spürte die Blicke. Ein Tropfen seines Blutes fiel auf den Boden – und die Erde saugte ihn auf, als sei sie durstig.
Eines der Wesen kroch näher, ein langes, dünnes Etwas mit zu vielen Armen. Seine Finger streckten sich nach Valerius aus, nicht aggressiv, fast zärtlich. Doch er spürte, dass eine Berührung sein Ende wäre.
Rumanja lachte. „Jetzt siehst du es, nicht wahr? Sie wollen dich zuerst. Deinen Tod. Dein Blut.“
Valerius atmete schwer, Schweiß mischte sich mit dem Blut an seiner Haut. Aber er sah auch Rumanja an – und bemerkte, dass sie selbst blutete. Feine Linien, die der Sternenstaub in ihre Haut geätzt hatte, liefen wie Risse. Ein Tropfen rann von ihrer Wange, fiel in den Boden.
Das Wispern änderte sich sofort. Es war kein Singsang mehr, kein Ruf nach ihm allein. Es war ein Chor. Gieriger. Wütender. Jetzt wollten sie beide.
„Falsch, Rumanja.“ Valerius’ Stimme war rau, voller Schmerz, aber fest. „Sie wollen den Stärkeren von uns – oder den Schwächeren. Sie wollen den Verlierer.“
Ihre Augen blitzten, und für den Bruchteil eines Augenblicks sah er Panik.
Dann stürzte sie sich wieder auf ihn.
Der Kampf begann erneut, diesmal mit den Blicken unzähliger Augen im Nacken, und Valerius wusste: Jeder Schlag, jeder Tropfen Blut entschied nicht nur über Sieg oder Niederlage. Sondern darüber, wem diese Zwischenwelt ihr nächstes Festmahl gönnte.
Der Boden bebte unter ihren Füßen, ein leises, stetiges Pulsieren, wie ein Herz, das in der Tiefe dieser Welt schlug. Valerius und Rumanja prallten aufeinander, wieder und wieder, doch die eigentliche Gefahr kam nicht mehr nur aus ihren Klingen und Klauen.
Die Zuschauer rückten näher.
Zuerst waren es nur ihre Stimmen, ein Wispern, das mal nach Gesang, mal nach Geflüster klang. Doch dann… veränderten sich die Stimmen. Sie wurden bekannt.
„Valerius… hilf mir…“
Eine Kinderstimme. Hoch, schwach, voller Angst.
Er erstarrte, nur einen Herzschlag lang. Es war die Stimme des Mädchens, das er einst getötet hatte – die erste, die ihn bis in seine Albträume verfolgte. Er sah sie nicht, doch der Klang ließ ihm das Schwert schwerer werden, als zöge ihn eine unsichtbare Kette nach unten.
Rumanja nutzte es sofort. Mit einem Schrei fuhr sie nach vorn, ihre Krallen blitzten, rissen durch seine Rüstung, schnitten Fleisch. Warmes Blut spritzte, tropfte auf den Boden – und das Wispern ringsum explodierte in einen Chor gieriger Laute.
„Blut! Blut! Blut!“
Doch das war nicht alles.
Valerius blinzelte, taumelte zurück, und plötzlich veränderte sich die Welt um ihn. Die graue Ebene verschwamm, der violette Himmel zerfloss. Stattdessen stand er in einem Dorf. Einem Dorf, das er kannte. Sein altes Dorf. Häuser aus Holz, der Geruch von Rauch und Kohle, Kinder, die lachten – und mittendrin stand sein Vater.
„Ein Mann ist, was er tut, Valerius“, sagte der Schmied, während er den Hammer auf den Amboss niederfallen ließ. Funken sprühten, orange, warm. „Nicht, was er war.“
Valerius stolperte auf ihn zu. „Vater…?“
Dann hörte er ein Fauchen hinter sich. Er wirbelte herum – und da war Rumanja, nicht mehr in ihrer vampirischen Gestalt, sondern als Frau, jung, schön, verführerisch. Sie lächelte. „Du hast mich hierhergebracht. Aber du könntest auch bei mir bleiben. Diese Welt nimmt, wen sie will… oder schenkt, was du dir ersehnst.“
Ihre Hand streckte sich nach ihm aus.
Doch der Boden unter ihr veränderte sich. Die Illusion brach. Die schöne Frau wurde zum Schatten, das Lächeln zu einem Riss, in dem Zähne wuchsen. Aus dem Boden schnellten Hände, grau und knochig, griffen nach ihr, nach ihm. Wesen, die sie beide nach unten ziehen wollten.
Valerius schrie auf, riss das Schwert hoch, und die Illusion zerplatzte wie Glas. Die graue Ebene kehrte zurück. Doch nun waren die Zuschauer nicht mehr am Rand. Sie standen direkt bei ihnen.
Ein Kind ohne Augen. Ein Mann, dessen Haut von innen nach außen gestülpt war. Eine Frau mit drei Mündern, aus denen gleichzeitig Lachen, Weinen und Flüstern drangen. Sie alle griffen nicht direkt an – noch nicht. Aber sie spielten.
Jedes Mal, wenn Valerius nach Rumanja schlug, sah er für einen Augenblick nicht sie, sondern jemand anderen. Ein Freund, den er einst gekannt hatte. Ein Opfer. Seine Mutter. Er musste das Schwert immer wieder gegen seinen eigenen Verstand führen, gegen das, was die Welt ihm vorspiegelte.
Rumanja kämpfte ebenfalls – das sah er. Auch sie taumelte, schnappte nach Luft, fauchte, wenn die Wesen sie in Illusionen zogen. Ihre Gestalt flackerte, wurde einmal zu einem Kind, einmal zu einem alten Mann. Sie kämpfte nicht nur gegen ihn, sondern gegen die Zwischenwelt selbst.
Die Wesen wollten Blut. Aber mehr noch – sie wollten Qual. Sie wollten sehen, wie die beiden Kämpfer nicht nur Körper, sondern Seelen zerfetzten.
Valerius’ Gedanken rasten. Jeder Schlag gegen Rumanja ließ die Zwischenwelt lauter werden. Jeder Tropfen Blut, der fiel, machte die Zuschauer gieriger. Bald würden sie nicht mehr nur beobachten. Bald würden sie stürzen, würden reißen, würden fressen.
Und irgendwo tief in ihm kroch die Erkenntnis hoch: Vielleicht war das der wahre Sinn des Portals. Nicht, dass einer von ihnen siegte. Sondern dass die Welt selbst ihr Mahl bekam.
Er spürte, wie etwas Kaltes seine Hand berührte. Reflexartig schlug er zu, zerschmetterte ein Gesicht, das keinen Schädel hatte. Die Kreatur schrie nicht. Sie lachte.
Rumanja keuchte, ihre Stimme rau, aber ehrlich in diesem Moment: „Wenn wir uns hier gegenseitig zerreißen… dann fressen sie, was übrig bleibt. Sie… werden gewinnen.“
Valerius’ Atem ging schnell, seine Brust hob und senkte sich. Er wusste, sie hatte recht. Doch er wusste auch: Er konnte ihr nicht trauen.
Die Zwischenwelt summte, vibrierte, als wolle sie beide Antworten hören: Kampf bis zum Tod – oder ein Bündnis gegen das, was sie umgab.
Und während die Wesen näher rückten, die Hände schon nach ihnen griffen, musste Valerius eine Entscheidung treffen, die ihm mehr Angst machte als jede Klinge.
Kapitel 24: Das Amulett der Macht
Die Ebene lag vor ihnen wie eine verlassene Bühne nach dem letzten Akt. Der Himmel – wenn es überhaupt einer war – war eine endlose, graue Fläche, von dünnen Rissen durchzogen, aus denen fahles Violett sickte. Das Licht hier war eine Lüge: gleichmäßig, aber nie aus derselben Richtung, und es ließ selbst den eigenen Schatten wie einen Fremden wirken.
In der Ferne ragten Baumgerippe auf, deren Rinde wie verbranntes Fleisch wirkte. Kein Blatt, kein Vogel, nur knorrige Äste, die bei jedem Puls des Amuletts minimal zitterten, als wären sie nervöse Zuschauer. Der Boden unter Valerius' Stiefeln war trocken, aber nicht fest – als würde man auf einer dünnen Kruste stehen, unter der etwas lebte und atmete.
Das Pochen
Valerius’ Hände zitterten, als er das Amulett hob. Es pulsierte träge, als wolle es ihn erst testen, dann schneller, fordernder – bis es den Rhythmus seines eigenen Herzens an sich riss und umformte. Jeder Schlag ging durch ihn hindurch, ein dumpfes Beben, das Muskeln, Knochen und Gedanken im gleichen Takt erzittern ließ.
Mit jedem Puls rollte eine Welle aus Licht und Schatten über die Ebene, ließ die Bäume knarren und die Gestalten zurückweichen, die sich im Halbdunkel versammelt hatten. Sie waren keine Kreaturen, wie man sie aus Geschichten kannte, sondern Collagen aus Dingen, die nie hätten kombiniert werden dürfen: Gesichter ohne Konturen, Münder, wo keine sein sollten, Augen, die sich wie Spinnenbeine bewegten.
Einige wanden sich, als träfe sie das Licht wie Feuer. Andere hielten ihre „Gesichter“ zu – falls es welche waren – und krochen dennoch näher, sabbernd, gierig, als ob sie genau wüssten: Dieses Licht ist Fluch und Erlösung zugleich.
Die Stimme der Jägerin
„Du spürst es auch, nicht wahr?“ Rumanjas Stimme war brüchig, aber immer noch gefährlich. Sie stand nur wenige Schritte entfernt, ihre Silhouette flackerte wie eine Kerze im Windzug. Ihre Haut wirkte matter als sonst, fast durchscheinend, doch in ihren Augen brannte etwas, das sich nicht löschen ließ.
„Das Amulett will nicht dich allein. Es will… uns. Es hungert.“
„Du redest, als würdest du wissen, was es denkt,“ entgegnete Valerius und merkte dabei, dass er schneller atmete. Er wollte es abstreiten, doch tief in seiner Brust wusste er: Sie hatte Recht.
Er erinnerte sich an das erste Mal, als er es gesehen hatte – nur ein Splitter, ein schmutziges Stück Metall, das ihm in die Hand gedrückt worden war. Schon damals hatte er den Druck gespürt, ein Flüstern am Rande des Gehörs, wie eine Hand an seiner Schulter. Jetzt war es kein Splitter mehr. Jetzt war es ganz. Und es lebte.
Die Zwischenwelt atmet mit
Unter ihnen begann sich der Boden zu wölben, als kroche ein gewaltiger Körper darunter entlang. Risse öffneten sich, schmal erst, dann breit wie Schwertklingen. Aus ihnen strömte violettes Licht, kalt und salzig wie Metall. Ein Grollen lief durch die Luft, so tief, dass es die Zähne in ihren Kiefern summen ließ.
„Es erwacht,“ flüsterte Rumanja. Und es war das erste Mal, dass ihre Stimme nicht nach Spott schmeckte – sondern nach Furcht.
Valerius hob das Amulett höher, und sofort war Bewegung in der Menge der Zuschauerwesen. Einige warfen sich zu Boden, andere rutschten auf Knien näher, die Glieder verdreht in unnatürlichen Winkeln.
In seinem Kopf, ganz nah an der Stelle, wo Erinnerungen wohnen, formte sich eine Stimme. „Du kannst es nicht kontrollieren… aber du kannst es freisetzen.“ Er wusste nicht, ob es das Amulett war oder die Dimension selbst, die sprach.
Er dachte: Nein. Aber er wusste auch: Ohne seine Macht würden sie hier nicht lange überleben.
Der Blick nach unten
„Es ist ein Anker,“ murmelte er, „ein Anker, der dich hier festhält, Rumanja. Und ich werde ihn benutzen.“
Sie lachte. Rau. Bitter. „Du? Benutzen? Du bist längst nur noch sein Gefäß. Du denkst, du trägst es – dabei trägt es dich. Sieh dir deine Hände an.“
Widerwillig blickte er hinab – und sein Herz stolperte. Die Haut war dunkler geworden, fast schwarz, durchzogen von feinen, leuchtenden Linien, die wie Kapillaren aus Licht pulsierten. Seine Fingernägel waren länger, spitz zulaufend, hart wie Horn. Er war dabei, sich zu verändern – nicht zufällig, sondern gezielt.
Das Schwert in seiner anderen Hand begann ebenfalls zu reagieren. Das Silber lief an, bekam schwarze Schlieren, kleine Risse öffneten sich und ließen dasselbe violette Licht hervortreten, das auch aus den Bodenrissen quoll. Als hätte die Klinge begonnen zu atmen – im Rhythmus des Amuletts.
„Nein…“ hauchte er.
„Doch,“ sagte Rumanja. „Es schreibt dich um.“
Der Schrei der Welt
Plötzlich stürzte sie vor. Kein Zögern, nur eine Bewegung, schnell wie ein Gedanke. Ihre Krallen rasten auf ihn zu.
Valerius hob instinktiv das Amulett – und dann kam der Schrei.
Er war nicht von ihr. Nicht von ihm. Es war der Schrei der Welt selbst.
Die Luft riss auf, ein Lichtblitz brach heraus, so heiß, dass es seine Haut prickeln ließ, so hell, dass selbst die Schatten der Bäume sich wanden. Rumanja wurde zurückgeschleudert, prallte hart auf, der Boden unter ihr brach wie dünnes Eis auf. Unter ihr gähnte eine Spalte, in der das Violett brodelte wie flüssiger Zorn.
Sie zog sich mit einem letzten Sprung auf festen Grund. Ihre Augen waren jetzt pures Gift – und dahinter Angst.
Das Flüstern kehrt zurück
Valerius stand keuchend da, das Amulett pochte in seiner Hand wie ein zweites Herz, synchron mit seinem eigenen – oder hatte es längst übernommen? Er wusste: Der Kampf war jetzt nicht mehr er gegen sie. Es war er gegen das Ding in seiner Hand.
Und irgendwo, gleichzeitig fern und nah, begann das Flüstern wieder:
„Opfere sie. Opfere dich. Opfere die Welt. Lass mich frei.“
Valerius schloss die Augen. Das Bild seines Vaters schob sich vor die violetten Lichter, dann das Mädchen mit den dunklen Zöpfen. Sie standen stumm, beobachteten ihn, sagten nichts – als wollten sie wissen, ob er selbst noch entscheiden konnte.
Er atmete aus, langsam, und spürte: Der wahre Kampf hatte gerade erst begonnen.
Kapitel 25: Die Jagd in der Zwischenwelt
Der erste Schritt in dieser Ebene fühlte sich an wie ein Fehltritt in einen Traum, aus dem man nicht mehr aufwachen konnte. Die Luft hatte Gewicht; nicht die Art von Schwere, die Sturm oder Regen bringen, sondern etwas, das in die Knochen kroch, als wolle es sie von innen heraus beschweren. Jeder Atemzug schmeckte nach altem Metall, nach einer Schmiede, die seit Jahrhunderten kein Feuer mehr gesehen, aber immer noch den Geruch von Blut im Stein hatte.
Das Grau der Welt war nicht gleichmäßig. Überall schwammen violette Schatten, die sich bewegten, ohne dass es Lichtquellen gab, die sie rechtfertigten. Knorrige Baumgerippe standen verstreut, ihre Rinde so weiß wie Knochen, vernarbt von Rissen, aus denen hin und wieder kaltes Leuchten sickerte. Manche dieser “Bäume” bogen sich, wenn man zu lange hinsah – als wollten sie hören, was zwischen den Herzschlägen geschah.
Zwischen den grotesken Stämmen duckte sich Valerius, atmete flach. Die Kälte kroch durch den Spalt im Panzer, den Rumanjas Krallen hinterlassen hatten, und biss in sein Fleisch. Er spürte das Gewicht des wiedervereinigten Amuletts in der linken Hand – und zugleich, dass es ihn führte, nicht umgekehrt. Jeder Schlag seines Herzens war im Gleichtakt mit dem Ding, das keinen eigenen Körper haben sollte.
Der Wechsel der Rollen
Rumanja war irgendwo voraus. Er hörte ihr Keuchen, das nicht zum Bild der unsterblichen Jägerin passte. Der Sternenstaub arbeitete sich durch ihre Adern, ließ die Wunden, die er ihr geschlagen hatte, nicht schließen. Jeder ihrer Schritte klang unsauber, als müsse sie über ihre eigenen Füße verhandeln.
Er glitt zwischen zwei Stämmen hindurch, die wie zusammengewachsene Wirbelsäulen aussahen, und erspähte sie – den Rücken krumm, die Bewegung abgehackt. Ihre Silhouette flackerte, als versuchte die Zwischenwelt selbst, sie aus dem Bild zu reißen.
„Lauf, Rumanja,“ murmelte er fast zärtlich. „Lauf.“
Dann trat er aus der Deckung, das Schwert tief und fest, und rannte an.
Der innere Chor
Das Amulett war wie ein aufgeregter Beifahrer in seinem Schädel.
„Schneller.“ „Tiefer schneiden.“ „Lass sie bluten. Lass sie fallen.“
Er schüttelte den Kopf, wollte den Lärm abschütteln, aber die Stimmen passten sich seinen Bewegungen an. Jeder seiner Hiebe klirrte im Takt des Wisperns. Ihre Schreie wurden zum Rhythmus.
Ein Bild blitzte vor seinem inneren Auge auf – kein Produkt des Willens. Paris, verregnet. Seine Schwester in einer schmalen Gasse. Hände, die sie packten, Zähne, die zu nah kamen. Das Amulett bohrte den Dorn tiefer: „Sie war mir egal. Dir auch, wenn du mich lässt.“
Sein Griff um den Schwertheft wurde noch fester.
Der Boden bricht
Rumanja stolperte, kniete kurz in einer Mulde zwischen zwei Rissen, und er sah seine Chance. Mit einem Satz war er bei ihr, die Klinge hoch – und die Welt unter ihnen beschloss, dass es Zeit für einen weiteren Akt war.
Der Boden riss auf, als würde jemand einen Reißverschluss öffnen. Violettes Licht quoll heraus, dick wie Nebel, aber pulsierend, als läge darunter etwas Lebendiges.
Daraus krochen sie: Gestalten, bei denen die Linien zwischen Fleisch und Rauch verwischt waren. Augen, rotglühend und tief, als gehörten sie zu Kohlen, die seit Jahrhunderten schwelen. Mündern zu groß für ihre Schädel, gefüllt mit Reihen kleiner Zähne, die im eigenen Licht glänzten. Sie bewegten sich in Intervallen, die das Auge nicht verstand – ein Ruck wie ein Schlag, dann ein Dahingleiten wie Treibgut.
Waffenbrüder wider Willen
Einer dieser Schattenhände griff nach Rumanja, riss ihr ein Stück Fleisch von der Schulter. Sie schrie – ein Laut, roh vor Schmerz und Überraschung – und stieß das Ding zurück. Das Blut dampfte, wo es den Boden traf.
„Sie riechen das Amulett,“ keuchte sie, eine Hand krampfhaft auf der Wunde.
„Oder uns,“ gab Valerius zurück, und es war unklar, ob er es als Witz oder Erkenntnis meinte.
Ein anderer sprang ihn an. Er riss das Schwert hoch, schnitt dem Ding den Kopf ab, der sich sofort wieder formte, als sei Rauch nur zu einem Kreis gelaufen.
„Sie gehören uns allen,“ säuselte das Amulett in ihm. „Aber nur einer kann herrschen. Töte sie. Töte sie alle.“
Er lachte kurz, ohne Humor. „Vielleicht später.“
Und dann geschah es: Sie standen Rücken an Rücken. Ihre Bewegungen flossen seltsam synchron. Seine Klinge beschrieb saubere, klare Linien, während ihre Krallen wie ein Funkenregen durch die Leiber der Wesen fuhren. Jeder Atemzug war Kampf. Jeder Herzschlag war Befehl.
Die Stille danach
Als das letzte Schattenmaul zischend zurückwich, fiel die Ebene in eine Stille, die nicht leer war, sondern lauerte. Der Himmel über ihnen zuckte in einem blassen Violett, als zöge jemand weit entfernt einen Vorhang.
Nur das Pochen des Amuletts blieb – hart, gierig, unausweichlich.
Rumanja drehte den Kopf zu ihm, langsam, wie eine Raubkatze, die den Sand prüft. Ihre Augen hatten den Hass nicht verloren, aber er mischte sich jetzt mit einer Offenheit, die verdächtig nach Angst aussah.
„Du wirst nicht gewinnen, Valerius,“ sagte sie, leise, aber jedes Wort eine Klinge. „Vielleicht tötest du mich. Vielleicht auch nicht. Aber am Ende…“ – sie deutete auf das Ding in seiner Hand – „… wird das dich zerreißen.“
Er hob das Schwert. Sein Griff zitterte nicht vor Müdigkeit, sondern vor etwas, das er nicht benennen wollte.
Und tief in ihm, hinter den Stimmen des Blutes und der Schlacht, kam es zurück:
„Nicht sie jagt dich, Valerius. Nicht die Schatten. Ich bin es. Ich jage dich.“
Kapitel 26: Das Echo der Vorfahren
Die Zwischenwelt summte wie eine alte Neonröhre kurz vor dem Flackern. Das Geräusch war so leise, dass es eher gedacht als gehört wurde, und doch kroch es Valerius in die Knochen, als hätte jemand eine Stimmgabel an seinen Schädel gelegt. Das Summen wurde zu einem Atem, der sich nicht an die Regeln seines Brustkorbs hielt. Die Luft schmeckte nach kaltem Zinn und dem bitteren Rest einer gelöschten Schmiedeglut.
Knorrige Stämme ragten in den violett verwaschenen Himmel, ihre Rinde gesprungen wie verbrannte Haut. Wenn der Wind – und hier unten war er weniger Wind als eine Entscheidung – durch die Äste fuhr, klang es, als rieben Knochen aneinander. In den Rissen des Bodens pulsierte das gleiche violette Licht, das alles beleuchtete und trotzdem kein Schattenrecht kannte. Der Boden war hart wie alte Keramik, rissig, als hätte eine unsichtbare Hand versucht, mit Nägeln Muster hineinzuschreiben.
Valerius stand breitbeinig in dieser Landschaft, sein Schwert tief, das Amulett hoch. Der Puls des Relikts lief ihm den Arm hinauf und legte sich um sein Herz, wie eine zweite, unhöfliche Faust. Er atmete ein und aus, zählte nicht, weil Zahlen hier zu träge wurden.
Das Flüstern kam nicht von vorn. Es kam von innen.
„Du hörst uns endlich,“ sagte eine Stimme, die nicht eine Stimme war, sondern der Eindruck von Wärme zwischen zwei kalten Gedanken.
Er drehte sich, ohne sich zu drehen. Am Rand seines Blicks lösten sich Umrisse aus dem Dunst – zuerst wie Lichthöfe, dann wie Schatten, die beschlossen hatten, dass sie Gesichter wollten. Schritt für Schritt bekamen sie Körper, Gewänder, Narben, Augen. Männer mit harten Kiefern, Frauen mit krummen Händen von Arbeit, Kinder mit ernsten Mündern, die zu früh altertümliche Wörter gekostet hatten. Leder, Kettenhemden, Leinen; Ketten, Siegelringe, Talismane an Fäden. Falkenbergs, alle.
Ganz vorn trat Theodora heraus. Ihr Haar fiel in schweren Strähnen über die Schultern, der Mund eine ruhige, feste Linie, die Augen wie glühende Kohlen, die Wärme spendeten, nicht verbrannten.
„Du bist nicht allein, Valerius,“ sagte sie. Es hallte nicht in der Luft, sondern dort, wo Worte nicht wehtun: hinter dem Brustbein, in der Kuhle unter dem Sternum.
Er schwankte, nur kurz. Sein Knie gab nach und fand sofort wieder Stand. „Mutter,“ brachte er heraus, und seine Stimme war Sand, den man schluckt.
Ihre Hand legte sich nicht auf seine Schulter. Und doch sank etwas Schweres, Tröstendes auf ihn, als hätte sie es getan. Wärme kroch unter seine Rüstung, dieses seltene, gute Feuer, das nicht brennt, sondern erinnert.
„Es ist Zeit,“ sagte sie leise. „Nicht nur für dich.“
Hinter ihr formierte sich die Linie seiner Toten. Ein Mann mit gebrochener Nase und einer Narbe über der Stirn, die wie ein Blitz aussah. „Roderich,“ flüsterte eine andere Stimme in Valerius’ Kopf. Daneben eine Frau mit schmalen Lippen, der Blick weich, die Hände zerkratzt. „Isabetta.“ Ein hagerer Gelehrter, der mehr Tinte als Blut in den Adern trug, ein Jäger mit einem Wolfsfell um die Schultern, eine Nonne mit einem Messer im Gürtel. Alle sahen ihn an, nicht fordernd, nicht verurteilend. Wach.
Das Amulett in seiner Hand beschleunigte. Der Takt kletterte, versuchte, sein Herz zu überholen, ihm den Stab aus der Hand zu nehmen. Jeder Schlag war ein Befehl, der keiner sein durfte. Gleichzeitig floss etwas zu ihm zurück, ein Strom von Gesten und Griffen, von Blicken, die treffen, bevor das Schwert es tut. Das Wissen sickert in ihn wie Wasser durch Leinen: nicht schnell, aber unaufhaltsam.
„Führ es zu Ende,“ sagte eine alte Stimme aus der Menge, rau und zärtlich zugleich.
„Wir stehen hinter dir,“ fügte eine jüngere hinzu.
„Dein Blut ist unser Blut,“ sang etwas, das mehr Chor als Person war.
Valerius schloss die Augen und öffnete sie wieder. Die Zwischenwelt blieb. Aber jetzt lag eine dünne Schicht von etwas anderem darüber, wie Klarlack über alten Buchstaben, der die Schrift plötzlich lesbar machte.
Rumanja hatte das auch bemerkt. Er sah es an der Art, wie sie die Zähne zusammenpresste, an dem zu langen Blinzeln, mit dem sie versuchte, die Erscheinungen wegzuwischen. Ihr Körper zuckte unter dem noch immer arbeitenden Sternenstaub. Die Kante ihres Lächelns war schief vor Zorn und … ja. Angst.
„Nein,“ keuchte sie, „das darf nicht sein. Ihr seid Geschichte. Ihr seid Asche. Der Name Falkenberg hätte schon vor hundert Jahren im Staub liegen müssen.“
Valerius antwortete nicht sofort. Als er den Mund öffnete, war es nicht nur seine Stimme. Sie hallte tiefer, breiter, ein Chor, der nicht schreien musste, um zu füllen. „Das Erbe der Falkenbergs lässt sich nicht auslöschen, Rumanja. Du kämpfst nicht nur gegen mich. Du kämpfst gegen Jahrhunderte.“
Theodora trat näher. Ihre Züge verschoben sich, wurden kantiger, strenger. „Aber pass auf,“ sagte sie und ihre Worte schnitten wie ein sauberer Schnitt. „Dieses Band ist scharf wie ein Schwert. Wir können dich stärken … oder zerreißen. Das Amulett will dich besitzen. Wir bändigen es – doch nur, solange du weißt, wer du bist.“
Das Amulett reagierte mit einem heiseren, stummen Auflachen. Es war kein Ton, eher ein Kältezug im Rücken. Valerius’ Finger krampften, das Licht in den Adern seiner Hand intensivierte sich, seine Nägel fühlten sich an, als wollten sie zu Haken werden.
„Er gehört mir,“ flüsterte die fremde Stimme in seinem Schädel und klang inzwischen erstaunlich vertraut. „Er war immer mein.“
„Er ist unser,“ antwortete Roderich, und sein Mund bewegte sich nicht einmal, als er sprach. „Und er ist seiner.“ Theodora hob zwei Finger, und die Gänge der Ahnen traten fester, die Linie hinter Valerius rückte dichter wie Soldaten vor einer Engstelle.
„Sag deinen Namen,“ befahl sie.
„Valerius Falkenberg,“ sagte er und fühlte, wie sich der Klang des Namens in seinen Knochen verankerte. Der Chor hinter ihm antwortete, jede Stimme machte eine andere Silbe stärker, als feierten sie ihn mit einer Litanei.
„Noch mal,“ sagte sie.
„Valerius Falkenberg.“
Das Amulett pulsierte, aber die Schläge trafen nicht mehr willkürlich. Sie prallten ab, fädelten sich in den Rhythmus seines Atems, wurden gezügelt, wenn nicht gezähmt.
Rumanja bewegte sich. Sie warf sich nach vorn, alle Muskeln ein einziges „Jetzt“. Ihre Krallen schnitten durch die Luft, zielten auf die Kehle, auf die Hand mit dem Amulett, auf das Herz, überall, wo man einen Schlussstrich ziehen kann.
Valerius wich aus, schneller als vorher. Nicht elegant, sondern notwendig. Ein Schritt, eine Drehung, die Schärfe seines Stahls zog Risse durch die Luft. Seine Klinge tanzte nicht mehr allein – Hände, die keine waren, führten mit. Ein kleiner, älterer Schlag, den er nie gelernt hatte, setzte sich wie ein Instinkt in seine Sehne, und die Spitze seines Schwertes fand Fleisch an einer Stelle, an der Rumanja früher leer gewesen war.
„Wer hat dir das verraten?“ zischte sie, als Blut – dunkler als in irgendeiner Welt – an ihrer Seite hervorquoll.
„Heinrich, 1521,“ antwortete eine Stimme hinter Valerius trocken. „Klauen meiden den dritten Rippenraum nicht, wenn sie gierig sind.“ Ein kurzer, knurrender Humor lief durch die Linie, so knapp, dass er kaum existieren durfte.
Valerius wechselte den Stand. „Isabetta,“ sagte er, und sein Fuß fand Halt auf einem Riss, der eben noch tiefer wirkte. „Nimm den Atem aus der Klinge,“ riet sie und er tat es, ließ den nächsten Hieb flacher kommen, so dass er nicht schnitt, sondern drückte. Rumanja wankte, stolperte nach links, genau in die Richtung, wo das Violett stärker pulsierte.
„Nicht dort,“ fauchte sie mehr zum Boden als zu ihm. „Nicht dorthin.“
„Dorthin,“ sagte Theodora ungerührt. „Immer dorthin, wo es nicht hin will.“
Das Flüstern schwoll an. „Führ es zu Ende,“ drängte die Linie. „Schließ, was offen ist. Schlag, wo es wehtut.“
„Oder,“ säuselte das Amulett, jetzt freundlich wie eine Schlange in der Sonne, „öffne. Öffne, Valerius. Lass sie alle herein. Lässt du mich frei, gibt es keine Schmerzen mehr, nur Gerechtigkeit. Erinnerst du dich an die Gasse, an ihre Hände, an ihre Zöpfe? Gib sie mir. Ich verschlinge die Schuld und spucke dich sauber aus.“
Theodoras Blick stach ihn. „Erinnere dich. Und entscheide trotzdem.“
„Ich erinnere mich,“ sagte Valerius, und seine Stimme zitterte, aber nicht vor Angst. „Ich entscheide auch.“
Er ging nach vorn. Ein Schritt, der keinen Lärm machte. Ein weiterer, der die Luft teilte. Rumanja wich zurück, stolperte wieder, aber ihre Augen blieben an ihm, als wäre er das einzige Licht in einer Welt, die sonst nichts mehr kannte. „Du denkst, dein Chor macht dich unsterblich,“ spottete sie, ohne Kraft. „Aber wenn die Tür erst aufgeht, singt niemand mehr.“
„Dann bleiben wir davor,“ antwortete er. „Wir haben Erfahrung mit Türen.“
Sie sprang, er sprang. Metall und Horn, Fleisch und Violett, Stimme und Summen trafen zusammen. Seine Klinge fuhr in einem Winkel, der ihm nicht gehörte und ihm doch natürlich war, und schlug gegen das Amulett an ihrem Hals. Ein Klang, gläsern, der im Raum nach oben stieg und dort hängen blieb wie eine verbotene Note. Die Runen auf beiden Relikten blieben dunkel – nur für einen Herzschlag – dann züngelte ein schmaler Lichtfaden zwischen ihnen, ein dünnes, singendes Band, das sofort gefährlich aussah.
„Nicht verbinden,“ murmelte Roderich. „Wenn sie sich küssen, beißt die Welt.“
Valerius riss zurück, und das Band zerriss, ohne zu reißen – es hörte auf zu existieren, als hätte es nie etwas bedeutet. Das Amulett in seiner Hand klagte, ein dumpfer, kindlicher Ton. Er ignorierte es. Theodora nickte.
„Jetzt,“ sagte sie. „Bind es.“
„Wie?“ fragte Valerius und merkte, dass seine Zunge trocken war, als hätte er staubiges Eisen gelutscht.
„Mit uns,“ antwortete Isabetta. „Mit Atem.“
„Mit Namen,“ sagte der Gelehrte. „Namen sind Haken.“
„Mit Arbeit,“ brummte der Jäger. „Nichts hält, was man nicht schlägt.“
Valerius hob das Amulett, drehte es, so dass die Runen nicht nach außen, sondern nach ihm zeigten. Das Licht pulsierte, wurde unruhig, als hasse es, gesehen zu werden, wo es wohnt. Er legte die Klinge seines Schwertes flach auf die Rückseite des Relikts, fühlte, wie Kälte durch den Stahl schoss und ihm den Arm hinaufbrach. Seine Zähne schlugen kurz aufeinander.
„Sag deinen Namen,“ befahl Theodora erneut.
„Valerius Falkenberg.“
„Sag den ihren,“ schnitt Isabetta dazwischen, und es klang fast grausam.
„Rumanja,“ sagte er, und der Klang war ein Spucken und ein Gebet.
„Sag den unseren,“ flüsterte der Chor.
Er tat es. Roderich. Isabetta. Heinrich. Theodora. Namen wie Nägel, die in Holz getrieben werden, bis das Holz daran erinnert, dass es tragen kann. Mit jedem Namen zuckte das Amulett, die Runen flackerten, als wollten sie weg. Mit jedem Namen legten sich unsichtbare Fäden vom Relikt in die Linie hinter ihm, dünn zuerst, dann fester, dichter, wie Sehnen in einem Bogen.
Rumanja bog sich, als sie es spürte. „Hör auf!“ schrie sie, die Stimme spröde. „Du bindest nichts als dich selbst!“
„Vielleicht,“ sagte Valerius. „Aber ich weiß, woran.“
Er atmete ein. Zählte, ohne zu zählen. Spürte, wie die Zwischenwelt für eine halbe Sekunde entschied, still zu sein. Dann presste er die Klinge fester an das Amulett und ließ seine Stimme fallen, dieses Mal nicht laut, sondern tief.
„Ich bin Valerius, Sohn von Theodora, Blut von Falkenberg. Ich nehme dich nicht. Ich halte dich. Du schlägst in meinem Takt oder du schlägst gar nicht.“
Das Relikt krampfte, als hätte es einen Körper. Eine Welle der Kälte ging durch ihn, die ihn fast auf die Knie zwang. Hinter ihm spannte sich der Chor an; er sah, ohne sich umzudrehen, wie Hände, die keine waren, sich an seine Schultern legten, an seine Ellbogen, an seinen Nacken. Wärme drückte den Frost zurück, hielt ihn nicht auf, aber machte ihn menschlich.
„Er erinnert sich,“ sagte Theodora, und jetzt klang in ihrer Stimme etwas, das aufatmen wollte. „Halte, Junge.“
Rumanja riss unterdessen an ihrem Band, die Finger versuchten, das Leder zu zerreißen, das ihr Amulett hielt. Die Zwischenwelt reagierte: Gleichmäßig blinkte das Violett im Boden auf, als ginge irgendwo jemand durch einen Flur und knipse nacheinander die Lichter aus. Ihre Augen waren nicht mehr nur Hass. Da war etwas wie Hoffnung – hässlich, leise, unangebracht. „Lass es,“ sagte sie. „Lass die Tür. Öffne. Nur ein Spalt. Wir können teilen. Einen Garten. Einen Amboss. Einen Mund voll frischer Luft.“
Er sah sie an. In ihren Zügen lag für einen Atemzug das Gesicht, das sie vielleicht einmal gehabt hatte, bevor Zähne und Zeit sie zur Waffe gemacht hatten. Es war da, dann wieder weg. „Ich habe keine Gärten verdient,“ sagte er. „Mein Amboss steht, wo ich stehe.“
Er ließ los. Nicht das Schwert. Nicht das Band. Nur den Atem.
Das Amulett reagierte. Der Puls fiel einen Schlag aus. Dann zwei. Dann fand er zurück – nicht mehr vorn, nicht mehr drängend. Daneben. Daneben konnte er leben.
Eine feine Linie brach zwischen seiner Hand und dem Relikt ans Licht – dünn wie Spinnenseide. Sie schimmerte, nicht blau, nicht violett, eher wie das Grau vor der Morgendämmerung, das keiner Farbe verpflichtet ist, aber alle verspricht. Die Linie lief von seinen Fingerspitzen in das Amulett und von dort in den Boden, und der Boden nahm sie an, als sei er durstig gewesen. Die Bäume hörten auf, sich zu neigen. Der Himmel hielt den Atem an.
„Es nimmt,“ murmelte der Gelehrte. „Gott sei Dank, es nimmt Namen und nicht Fleisch.“
Rumanja stürzte. Nicht auf ihn. Weg von ihm. In eine Richtung, in der die Risse im Boden enger standen, wie Nägel einer fallenden Leiter. „Es reicht!“ schrie sie, und ihre Stimme zerfiel am Ende in ein Tiergeräusch, das niemandem gut stand. „Ich war zuerst hier. Ich habe zuerst gejagt!“
„Und ich werde zuletzt halten,“ sagte Valerius. „So wird aus Jagd Geschichte.“
Er sprang ihr nach. Die Linie hinter ihm bewegte sich nicht, sie war da, immer, wie ein Rücken, der nicht weicht. Seine Klinge fuhr und fand das Band ihres Amuletts. Ein sauberer Schlag, kein Hass, nur Notwendigkeit. Leder riss. Das Herz der Leere flog, zeichnete eine dunkle Kurve in der violetten Luft und blieb dann, entgegen jeder Logik, wie an einem unsichtbaren Haken hängen.
Rumanja erstarrte. Ein Laut, so klein, dass er schmerzte, löste sich aus ihr. Sie griff ins Leere, packte nichts, fand nichts. In ihrem Blick war plötzlich nichts als Mensch – und das war das Grausamste an diesem Moment.
„Bitte,“ sagte sie. Ein Wort, so ungewohnt in ihrem Mund, dass es stolperte. „Nicht so.“
Valerius’ Mutter trat neben ihn. Ihre Hand, die nicht da war, wurde schwer auf seinem Arm. „Erbarmen ist keine Tür,“ flüsterte sie. „Es ist ein Rahmen. Du entscheidest, was er hält.“
Er senkte das Schwert nicht. Aber er neigte das Amulett. Nur einen Hauch. Das Licht darin blinzelte, als hätte es etwas verstanden, das nicht ausgesprochen worden war.
„Geh,“ sagte er zu Rumanja. „Nimm dein Leben und geh. Jag mich nicht. Jag niemanden. Oder komm, und ich bin nicht mehr allein.“
Sie blinzelte. Ein Ruck ging durch ihre Schultern, ein Zucken, als wolle sie lachen und wisse nicht mehr wie. „Du lügst,“ flüsterte sie, ohne Zähne. „Du lügst schön.“
„Vielleicht,“ gab er zurück. „Aber heute lüge ich langsamer als du.“
Sie wich zurück, Schritt für Schritt, bis der Dunst sie nahm und nur ihr Atem blieb, der halb nach Eisen, halb nach Regen roch. Dann war sie fort – nicht gelöst, nicht erlöst, nur fort.
Die Zwischenwelt exhalierte. Das violette Licht sank eine Nuance. Die Bäume standen still wie Figuren, denen man die Anweisung entzogen hatte. Das Summen in Valerius’ Kopf ebbte nicht ab. Es veränderte Ton, wurde wärmer, weniger Nerv. Theodora stand vor ihm, und in ihren Augen lag Stolz, der nicht strahlte, sondern hielt.
„Es ist nicht vorbei,“ sagte sie. „Es fängt gerade erst an. Du hast einen Knoten gemacht. Knoten halten, bis jemand sie schneidet.“
„Ich weiß,“ sagte er. „Aber er hält.“
Die Linie der Ahnen regte sich, als hätten irgendwo Stühle gerückt. Roderich hob zwei Finger, als salutierte er, und verschwand als erster. Isabetta ließ ihre Hand durch sein Haar fahren, ohne es zu berühren. „Atem, Junge. Vergiss den Atem nicht.“
Der Gelehrte neigte den Kopf. „Schreibe deinen Namen auf etwas, das nicht brennt.“
Der Jäger schnaubte. „Und iss was.“
Einer nach dem anderen lösten sie sich auf, nicht in Nichts, sondern in die Art Stoff, der bleibt, wenn keiner hinsieht. Zuletzt blieb Theodora. Sie trat so nah, wie eine Tote nur treten kann, und er roch plötzlich Pflaumen und Eisen und das Lederband, das sie früher um das Haar getragen hatte.
„Wer bist du?“ fragte sie kein bisschen sanft.
„Valerius Falkenberg,“ sagte er das dritte Mal, und diesmal hörte die Welt zu.
„Gut,“ sagte sie. „Dann halte.“
Sie verschwand. Die Luft war leerer, aber nicht kalt. Das Amulett ruhte schwer in seiner Hand, sein Puls nicht mehr vor, nicht mehr hinter, sondern neben. Der Boden unter ihm knackte leise. In der Ferne – und in dieser Welt ist Ferne ein Trick – blinkte etwas wie ein Augenpaar. Vielleicht Rumanja. Vielleicht etwas anderes, das Angst vor Namen hatte.
Valerius steckte das Schwert nicht ein. Er ließ die Klinge locker an der Seite, als sei sie ein Gesprächsthema. Er atmete. Eins, zwei, drei. Der Boden antwortete nicht. Gut.
„Führ es zu Ende,“ hatte die Linie gesagt. Aber Enden sind auch Nähte.
Er ging. Nicht schnell. Nicht langsam. Schritt für Schritt, der Blick auf die Risse, die Hand am Amulett, dessen Licht jetzt so schwach war wie das Leuchten eines Glühwürmchens in einer Kinderhand. Hinter ihm nichts als sein Schatten, der hier keiner sein wollte. Vor ihm Bäume, deren Äste sich nicht mehr bückten.
Und irgendwo, weit entfernt und doch in der Nähe seiner Haut, griff Paris nach seinem Namen wie nach einem Faden. Er fühlte es, wie man einen Wetterwechsel fühlt: ein Druckwechsel in der Erinnerung, eine Glocke, die jemand anstößt, ohne dass sie zu läuten beginnt.
„Noch nicht,“ sagte er halblaut, zu wem auch immer. „Noch nicht.“
Die Zwischenwelt summte. Das Echo der Vorfahren hing noch in seinen Knochen. Und das Amulett, das hungrige, lernte – wenn auch widerwillig – wie man neben einem Herz schlägt, ohne es zu nehmen.
Kapitel 27: Der Wendepunkt
Die Zwischenwelt war zum Bersten gespannt. Jeder Atemzug, den Valerius tat, ließ den Boden unter seinen Füßen vibrieren – ein tiefes, träges Zittern, als würde die Dimension selbst dem Schlagabtausch lauschen und ihr Urteil vorbereiten. Aus dem violetten Dunst, der wie zäher Rauch zwischen den knorrigen Stämmen hing, drangen dumpfe, organische Laute: ein Knacken, ein fernes Klopfen, als würden irgendwo in der Tiefe Wurzeln brechen. Die „Bäume“ selbst – groteske Säulen aus verdrehtem, vernarbtem Holz und Knochen – schienen sich zu regen, ihre Äste wogten wie Arme, die das Schauspiel nicht stören, aber auch nicht versäumen wollten.
Zwei Augen, zwei Abgründe
Das Licht der vereinten Amulette lag wie eine Brücke zwischen ihnen, ein scharfkantiger Strahl, der jeden Staubpartikel in der Luft wie schwebendes Glas wirken ließ. In Rumunjas Blick spiegelte es sich – erst Feuer, lodernd und wütend, dann Leere, schwarz und grenzenlos. Sie schwankte, suchte Stand, stolperte über einen Wurzelkranz, der sich wie eine Krone um einen Riss im Boden gelegt hatte.
„Nein…,“ stieß sie hervor, die Stimme brüchig, geschnitten von einer Angst, die sie nicht aussprechen wollte. „Du kannst mich nicht besiegen!“ Das letzte Wort klang wie eine Bitte an sich selbst.
Valerius spürte die brennende Präsenz jeder Muskel- und Sehnenfaser. Seine Hand umklammerte den Griff seines Silberschwertes wie ein Seil, an dem man hängt, wenn es nur diesen einen Ausweg gibt. All die Trainingsstunden unter kalten Gewölben, die Geschichten seiner Mutter, das Wispern der Ahnen in seinen Träumen – sie verdichteten sich zu einer einzigen Wahrheit: Der Augenblick war da.
Der Griff ins Herz der Nacht
Mit einer Bewegung, die eher einem Schnitt durch Zeit als durch Raum glich, fuhr er vor. Die Klinge blitzte im Amulettenlicht, flüssiges Mondlicht über Stahl. Er packte nach ihrem Hals – nicht nach Fleisch, sondern nach dem, was sie hielt: das Herz der Leere. Ein schwarzer, pulsierender Tropfen Nacht glitt unter seinen Fingern hervor, kalt wie erstarrtes Quecksilber.
Das Relikt suchte instinktiv das Herz der Schatten, und als sie sich berührten, brach das Licht aus ihnen heraus: ein Schlag aus gleißendem Weiß, der die Schatten zerriss und jede Form neu zeichnete. Die Bäume flackerten in kränklichem Violett, der Boden spannte sich unter den Füßen, als hielte er den Atem an.
Sternenstaub wirbelte auf, getrieben von einer unsichtbaren Strömung, und legte sich wie ein rauschender Mantel um Valerius. Dabei sog er Rumanjas Kraft ab, Tropfen für Tropfen, und fütterte zugleich das Beben unter ihren Füßen.
Die Fratze der Furcht
Rumanja stolperte zurück, ihre Gestalt zerfransend wie altes Pergament im Feuer. Der Schrei, der aus ihr kam, trug Splitter – Schmerz, Zorn, aber vor allem den dunklen Geschmack nackter Angst. „Du… du kannst das nicht!“ Ihre Stimme schwankte, verformt vom Vibrieren der Zwischenwelt.
Valerius sah, wie ihr schützender Mantel aus Nacht bröckelte. Risse glühten darin wie Adern aus glühender Lava. Ihre „Unsterblichkeit“ – dieses selbstgefällige Schild – war nicht mehr als dünnes Eis über zu warmer Strömung. Jeder Herzschlag der vereinten Amulette ließ es ein Stück weiter aufbrechen.
Die Welt bezieht Stellung
Der Boden dröhnte in langen Pulsschlägen. Äste reckten sich zu ihnen, Schatten zuckten wie zuckendes Fleisch. Vom Himmel regnete Sternenasche, feine Funken, die lautlos verglühten, bevor sie den Boden berührten. Die Luft knisterte, scharf, als wäre sie geladen. Jeder Atemzug schmeckte nach Ozongeruch vor einem Gewitter und nach Metall, das zu lange im Blut gelegen hat.
In seinem Schädel brandeten die Stimmen seiner Ahnen, keine fremden Mahner mehr, sondern ein Trommelfeuer. Er hörte den rauen Bass seines Urgroßvaters, der ihn lehrte, niemals im ersten Zug alles zu setzen. Er hörte Theodoras warme Härte: „Jetzt ist die Klinge nicht nur dein Arm, sondern unser aller Arm.“ Und darunter – tiefer, älter – das brummende Einverständnis einer Blutlinie, die sich gegen den Strom stemmen konnte.
Die Versuchung
Doch je mehr ihre Kraft ihn trug, desto schwerer wurde es, er selbst zu bleiben. Das Amulett pochte wie ein Tier, das aus dem Käfig will. Flackernde Bilder stießen in seinen Geist: Rumanja, schon gefallen, reglos; er, hoch erhoben, eine neue Welt vor sich – eine Welt, die nach seinem Atem ging. „Nur ein Schritt, nur ein Gedanke,“ raunte etwas in ihm, „und alles gehört dir.“
Er wusste, dass dieser Wendepunkt zwei Klingen hatte: Die eine würde Rumanja endgültig zerschneiden. Die andere – ihn.
Der Sprung ins Unumkehrbare
„Jetzt,“ flüsterte er, mehr zu seinen Ahnen als zu sich. „Jetzt endet es.“
Er stürzte vor, die Klinge in einer Linie, so perfekt, als hätten Dutzende Hände sie geführt. Rumanja hob abwehrend die Arme, aber das Licht der Amulette stieß sie zurück, als hätte sie gegen den Atem eines Sturmes anzukämpfen.
Ein Donnerschlag aus purer Energie rollte durch die Zwischenwelt. Sterne fielen, manche platzten in grellen Schreien, andere glitten lautlos in den Dunst. Schatten schrien zurück, formten Wörter, die keine Sprache hatten.
Das Echo der Macht fuhr an jedem Baum hoch, durch jede Risslinie im Boden, und etwas – vielleicht die Dimension selbst – neigte sich vor, um zu sehen.
Dies war der Wendepunkt. Hier, zwischen Herzschlag und Atemzug, würde sich entscheiden, wer blieb, wer fiel – und ob die Dunkelheit diesen Namen je wieder vergessen konnte.
Kapitel 28: Die Höhlen von Kandahar – Ein Echo der Prophezeiung
Das Licht, das aus den vereinten Amuletten schoss, war kein einfaches Strahlen mehr – es war eine Lanze aus scharfem Feuer, die durch den Stoff der Zwischenwelt bohrte. Für einen brennenden Herzschlag schien jede Farbe ausgelöscht, als hätte jemand die Seele der Dimension umgedreht und die rohe, grelle Unterseite offenbart.
Die knorrigen Bäume, diese stummen, unheimlichen Beobachter, verdrehten ihre Leiber, als wollten sie nicht länger Zeugen sein. Ihre Äste rangen in der Luft, rissen im Lautlosen voneinander, wie Kreaturen, die von einer alten Schuld gefesselt waren. Der Boden vibrierte, Risse sprangen auf, und durch die Spalten sah Valerius ein pulsierendes Dunkel, das nicht leer war, sondern… lauerte.
Das Zerbrechen der Jägerin
Rumanja, einst so unerschütterlich wie der Fels selbst, war nur noch ein verzerrtes Abbild ihres alten Ichs. Das silberviolette Glühen des Sternenstaubs nagte an ihr, zerriss jede Arterie ihrer Macht. Ihre Haut flackerte zwischen Fleisch und Schatten, unentschlossen, was sie noch sein durfte. „Nein…!“ Ihr Schrei war nicht nur Laut – er war etwas, das man fühlte, tief im Brustkorb, eine Welle aus Wut und nackter Furcht.
Das unsichtbare Band, das von den Amuletten ausging, spannte sich zwischen ihnen, pulsierte im Rhythmus eines Herzens, das nicht von dieser Welt war. Rumanja krümmte sich gegen den Sog, doch jeder Widerstand ließ sie nur tiefer hineingeraten. Ihre roten Augen irrten zwischen Hass und – ja – Verzweiflung.
Vor ihnen öffnete sich der Riss.
Eintritt ins Maul der Prophezeiung
Es war keine simple Spalte. Es war, als habe jemand den Himmel aus der Realität gerissen, und dahinter lag ein Mahlstrom aus Farbe und Kälte. Strudel aus Sternenlicht und schwarzem Feuer rotierten gegeneinander, und am Rand dieses Tores stand eine Kante aus scharfem Weiß, das schnitt, wenn man es ansah.
Der Sog war sofort da – kein Wind, sondern eine Entscheidung, die getroffen worden war. Die Luft verließ seine Lungen wie in einem Sturz, die Muskeln in Armen und Beinen spannten sich bis zum Schmerz. Das Amulett in seiner Faust wurde glühend, als wolle es sowohl entkommen als auch festhalten.
Valerius’ letzter Blick auf die Zwischenwelt zeigte Rumanjas verzerrte Silhouette – dann zerriss alles.
Der Atem der Höhlen
Dunkelheit. Nicht das Fehlen von Licht, sondern eine Textur, eine Substanz. Er roch Staub, so alt, dass er schon lange keinen Namen mehr trug. Der Geschmack von trockenem Stein und etwas Bitterem, das an alte Grabkammern erinnerte.
Schroffe Felsformationen ragten wie schwarze Titanenfinger in die Höhe. Die Wände wirkten feucht und trocken zugleich, wie etwas, das vor Äonen einmal gelebt hatte. Ein Wind, messerscharf und doch träge, kroch durch Spalten und schluchzte in einem Ton, der zwischen menschlichem Flüstern und tierischem Heulen pendelte.
Die Prophezeiungen sprachen von diesen Höhlen. In bröckeligen Schriften, in Geschichten, die nur bei Kerzenlicht erzählt wurden, war dies der Ort, an dem die Dunkelheit gebrochen oder für immer entfesselt werden würde.
Die Beobachtung der Steine
Die Felswände selbst wirkten wachsam. Überall zogen sich Zeichen entlang: eingeritzte Glyphen, verwittert, aber noch immer klar wie Narben in der Haut einer alten Narbe. Sie glühten schwach im Licht der Amulette, pulsierten langsam, als reagierten sie auf Valerius’ Herzschlag. In feinen Rissen bewegte sich Staub, wie Atemzüge durch Nasenlöcher aus Stein.
Er setzte einen Schritt vor. Das Echo seines Trittgeräuschs brach nicht ab, sondern rollte weiter, tiefer, begleitet von einem leisen, beinahe fragenden Hall. Der Boden war übersät mit Knochensplittern – manche menschlich, manche von Dingen, deren Anatomie er nicht kannte.
Die Jägerin am Boden
Rumanja lag wenige Schritte entfernt, umhüllt vom Nachleuchten der Amulette. Ihre Schultern hoben und senkten sich flach, jeder Atemzug wie ein Riss in einer Porzellanfigur. Die Schatten, die sie umgeben hatten, zogen sich zurück wie Wasser vor einer unsichtbaren Küste.
Als sie den Kopf hob, sprach sie nicht mehr wie die Königin der Dunkelheit, sondern wie ein Tier, das merkt, dass sein Rudel tot ist. „Du… denkst, du hast gewonnen.“ Ihre Stimme kratzte wie ein Messer über Glas. „Aber selbst hier –“ sie hustete trocken – „gibt es Kräfte, die älter sind als deine Klinge. Mächte, die dich verzehren werden, ehe du sie begreifst.“
Das Echo der Linie
Das Pochen des Amuletts schlug in ihm im Gleichklang mit etwas anderem – dem Chor seiner Ahnen. Kein fernes Rufen mehr, sondern Atemzüge im Nacken, Hände, die seine Schultern hielten. Er spürte Theodoras Blick wie einen Strahl in der Finsternis.
„Wir sind hier,“ flüsterte eine Stimme, dumpf, aber klar wie ein Hammerschlag. „Dieser Ort wird entscheiden, nicht sie.“
„Nicht der Stein entscheidet,“ mischte sich eine tiefere Stimme ein, „sondern was du ihm bietest.“
Der Moment der Entscheidung
Er hob das Amulett. Das Licht darin begann zu flackern, als würde es seine eigene Spannung kaum halten können. Die Wände reagierten sofort – tiefe Vibrationen liefen durch den Boden, und ein kaum hörbarer Ton stieg an, wie der Beginn eines Psalms, den niemand mehr ganz kannte.
Schatten in den Spalten der Felsen zogen sich zurück – nicht vor Furcht, sondern vor Respekt. Ein Schwall Energie fuhr durch die Höhle, packte Rumanja wie mit unsichtbaren Händen und hielt sie fest.
Valerius’ Atem ging schwer, doch er war fest. „Dies endet hier, Rumanja.“
Sie lachte heiser, blutleer. „Nein, Valerius. Hier beginnt es.“
Ein Stück Fels knackte und löste sich, als wollte die Höhle selbst das Gespräch unterbrechen.
Zwei Gestalten. Eine Prophezeiung, die atmete. Und der Raum, uralt und lebendig, der auf den nächsten Zug wartete.
In der Finsternis der Höhlen von Kandahar hing das Schicksal an einer Klinge – und an einem Herzschlag, der nicht allein schlug.
Kapitel 29: Das Labyrinth des Verderbens
Die Höhlen von Kandahar lagen vor Valerius wie das geöffnete Maul eines uralten Raubtieres, dessen Atem aus tiefen, versteckten Schlünden strömte. Der erste Schritt hinein war wie ein Eintritt in eine andere Realität – eine Welt, in der der Stein lebte, horchte und urteilte.
Das Gewölbe atmete in langen, flachen Pulsen. Jeder Laut – der Knirschen seiner Stiefel auf feuchtem Geröll, das dumpfe Pochen seines Herzens – wurde verschluckt, verformt und als gedämpftes Echo zurückgeworfen. Das Licht der vereinten Amulette vor seiner Brust pulsierte, nicht im Takt seines Herzens, sondern in einer eigenen, unruhigen Kadenz. Es war kein sanfter Schein, sondern ein zitterndes Auflodern, das tiefe Schatten schuf, die wie neugierige Augen an den Wänden hingen.
Die Geisterhafte vor ihm
Vor ihm glitt Rumanjas Silhouette durch die Dunkelheit. Ihr Körper, gezeichnet von Sternenstaub und den Schlägen seiner Klinge, war nur noch ein Schemen. Der einst geschmeidige, lautlose Schritt war schwer geworden, schleppend. Der röchelnde Klang ihres Atems hallte von den Wänden wider.
„Du kannst mich nicht fangen…“ Es war kaum mehr als ein Hauch, doch in ihrem Ton lag ein eigentümlicher Zorn, gemischt mit dem Zittern von etwas, das gefährlich nah an Furcht war.
Valerius’ Mund verzog sich zu einem harten Lächeln, das nicht seine Augen erreichte. „Dann lauf schneller.“ Seine Stimme war tiefer, kratziger als sonst – nicht nur vor Anstrengung, sondern von der Last der Stimmen seiner Ahnen, die in seinem Schädel mitschwappten wie Wasser in einer alten Schale.
Die Prüfung des Gesteins
Die Höhlen schienen bewusst Wege zu öffnen und wieder zu verschließen. Manche Gänge waren eng wie Schluchten zwischen Rippen, andere weiteten sich abrupt zu Hallen, deren Dächer in eine endlose Schwärze ragten.
Die Wände fühlten sich unter seinen Fingerspitzen rau an, als wären sie aus mehreren Schichten übereinandergeschichteten Blutes gebaut worden. Stellenweise fühlte er eine schmierige Feuchtigkeit, als weinten die Steine selbst. Aus unsichtbaren Rissen tropfte Wasser, das nach Eisen schmeckte, und irgendwo tiefer im Fels hörte er das gleichmäßige, dumpfe Schlagen von etwas, das kein Herz sein durfte – zu groß, zu alt.
Von irgendwoher wehte ein Laut: das metallische Klirren einer Kette, die im Nichts schwang, gefolgt von einem Wispern, das jede Silbe verdrehte, als spräche die Unterwelt selbst. Die Höhle prüfte ihn – und sie kannte alle Prüfungen, die ein Herz brechen können.
Der Abgrund
Rumanja verschwand um eine Ecke, und Valerius’ Schritte führten ihn an den Rand eines gewaltigen Abgrunds. Er trat so nah heran, dass lose Steine unter seinem Stiefel absprangen und lautlos in die Tiefe fielen. Dort unten war keine Form, keine Bewegung – nur Dunkelheit so vollkommen, dass sie jede Vorstellung verschluckte.
Rumanja stand am gegenüberliegenden Rand, kaum zehn Schritte entfernt, und ihr Lächeln schnitt wie ein Splitter aus Eis in sein Bewusstsein. „Valerius… glaubst du wirklich, dass du das Ende bestimmen kannst?“ Ihr Ton war lauernd, ihr Blick glühte wie zwei glimmende Kohlen, tief in den Höhlenhöfen ihrer Augen.
„Jemand muss es tun,“ gab er zurück.
Der Boden vibrierte unter ihnen, wie ein dumpfer Atemzug eines schlafenden Giganten.
Die Kaverne der Entscheidung
Sie führte ihn tiefer, bis sich der Gang zu einer gewaltigen Kammer öffnete. Die Decke verschwand im Schwarz, und aus den Felswänden ragten säulenartige Strukturen, die aussahen wie versteinerte Wächter. Über den Boden waren Steine verstreut, in Form und Größe wie Knochen eines gewaltigen, längst verstorbenen Wesens.
An den Wänden glommen Runen in altem Licht – nicht hell genug, um den Raum zu erleuchten, aber stark genug, um ein unheilvolles Muster zu zeichnen: Geschichten von Schlachten, Dämonen, gebrochenen Eiden. Die Symbole schienen zu flüstern, wenn er sich zu lange auf sie konzentrierte.
„Dies…“ Rumanjas Stimme war jetzt brüchig, „… ist der Ort, an dem alles endet.“ Sie stand in der Mitte, die Arme leicht ausgebreitet. Die Schatten hingen an ihr wie Fetzen eines zerrissenen Mantels. Bei jedem Flackern der Amulette flimmerte ihre Gestalt zwischen dieser Welt und einer anderen.
Das Echo der Blutlinie
Valerius’ Angst – dieser leise Rest, der in ihm gezittert hatte – fiel in sich zusammen. Das Echo seiner Vorfahren stieg in ihm an, Stimmen, die sich wie eine feste Mauer hinter ihm aufbauten. Hände – unsichtbar, aber unverkennbar – legten sich auf seine Schultern, drückten Kraft hinein. Augen, dutzende, sahen mit ihm, richteten ihn aus.
„Sie ist schwach,“ sagte Theodoras Stimme, warm und schneidend zugleich. „Aber sei wachsam – die Schwäche ist der Ort, an dem ihr Gift am reinsten ist.“
„Treffe schnell,“ brummte Roderich. „Treffe hart.“
Die letzte Annäherung
Valerius hob das Schwert, dessen Klinge im Licht der Amulette wie flüssiges Quecksilber glänzte. Jeder Schritt auf Rumanja zu war ein Schritt gegen den Sog der Dunkelheit, die sich um sie sammelte. Die Zeit streckte sich, Sekunden wurden zu zähen Fäden, die sich um seine Glieder legten.
Rumanja hob das Kinn, und für einen Moment, nur einen Wimpernschlag, zeigte ihr Gesicht etwas, das fast wie Akzeptanz aussah – oder war es Berechnung?
„Du wirst verlieren, Valerius,“ hauchte sie. „Nicht, weil du schwach bist. Sondern weil du glaubst, stärker sein zu müssen, als du bist.“
„Und du,“ erwiderte er, „wirst fallen, weil du vergessen hast, dass man auch ohne Unsterblichkeit kämpfen kann.“
Er stürmte vor. Die Höhlen hielten den Atem an. Das Licht der Amulette fraß die Schatten, und die Wände zitterten, als wollten sie den Ausgang versiegeln.
Dies war nicht mehr nur ein Kampf zwischen zwei Gegnern – es war das Ringen einer ganzen Welt in Stein, Blut und Atem. Und das Labyrinth, das sie verschlungen hatte, würde nun Zeuge sein, ob es sie jemals wieder ausspucken würde.
Kapitel 30: Das Herz der Höhlen
Valerius setzte einen Schritt vor den anderen, das Gewicht der vereinten Amulette wie ein lebendiger Puls in seiner Hand. Die Gänge des Labyrinths waren jetzt so eng, dass seine Schultern den feuchten, kalten Stein berührten. Die Wände hatten etwas Elastisches, als würden sie nachgeben und gleichzeitig zurückdrängen. Bei jedem Schritt knirschte uralter Staub unter den Stiefeln, als betrete er die Überreste von etwas, das nicht nur tot, sondern vergessen war.
Die Luft war schwer und klebrig, angereichert mit dem Geschmack von Metall und Moder. Jeder Atemzug fühlte sich an, als schlucke er einen Teil dieser Höhlen in sich hinein, als trüge er Stück für Stück ihre Dunkelheit in seine Lungen. Das Licht der Amulette war eine zitternde Insel in einem Ozean aus Schwärze. Doch es reichte, um die Symbole an den Wänden zu erwecken – eingeritzte Zeichen, deren Linien noch immer frische Schärfe zu besitzen schienen, als hätte jemand sie gestern in den Stein geschnitten. Sie funkelten matt, als läge unter der Steinoberfläche ein eigenes Herzschlaglicht. Aus den Symbolen sickerte ein ständiges, leises Murmeln, als stimmte eine unsichtbare Menge einen uralten, endlosen Gesang an. Er konnte keine einzelnen Worte fassen, nur einen Klang, der wie eine Mischung aus Mahnung und Drohung in seinen Kopf kroch.
Die Prüfung des Sternenstaubs
Je weiter er voranschritt, desto zäher wurde die Luft. Ein feiner, silbrig funkelnder Nebel trieb im Gang – Überbleibsel des Sternenstaubs, der sich seit der Schlacht in der Zwischenwelt hierher verirrt hatte. Der Staub glitt an seiner Haut entlang, wie winzige Finger, die prüften, wo er schwach war. In seinem Kopf versuchte er, sich einzunisten, flüsterte Dinge, die nicht seine Gedanken waren:
„Du bist zu spät… zu schwach… sie wird dich in die Tiefe ziehen.“
Valerius biss die Zähne zusammen, fixierte den Lichtkern in seiner Hand. Das Amulett pochte dagegen an wie ein Herz, das sich nicht unterkriegen lassen wollte, und schickte Hitze in seine Finger, seinen Arm, bis in die Brust. Mit jedem Schlag dieser Hitze wurden die flüsternden Stimmen leiser.
Die Große Kaverne
Als sich der Gang öffnete, verschluckte ihn ein Raum, so gewaltig, dass seine Ausmaße nur zu erahnen waren. Die Decke verlor sich in einer Dichte aus Finsternis, die selbst das Licht der Amulette nicht durchdrang. In der Mitte tat sich ein Abgrund auf, ein Schlund, aus dem ein eiskalter Atem drang. Die Kälte kroch an seinen Beinen hoch und hinterließ eine Spur aus Gänsehaut. Es war, als stünde er vor dem geöffneten Maul eines Lebewesens, das so alt war wie die erste Nacht der Welt.
Der Boden rund um den Abgrund war gespickt mit Rissen, und an deren Kanten glomm ein unheilvolles, rotes Licht, das in unregelmäßigen Pulsen durch die Steine schoss. Das Geräusch, das aus der Tiefe drang, war nicht einfach Wind – es klang wie das langsame, tiefe Atmen einer schlafenden Masse, die nicht geweckt werden wollte.
Die Jägerin am Rand
Rumanja stand am äußersten Rand des Abgrunds. Sie wirkte kleiner, eingefallener, doch ihr Blick war noch immer der einer Königin, die ihr Reich nicht kampflos preisgibt. Die Haut spannte sich pergamentdünn über ihre Knochen, riss an manchen Stellen wie altes Papier, das zu lange in der Sonne gelegen hatte. Ihr Haar hing in zerschlissenen Strähnen herab, und in den tiefen Höhlen ihrer Augen glomm das letzte Licht eines Feuers, das sich weigerte, zu verlöschen.
„Du wirst niemals siegen, Jäger!“ zischte sie, und ihre Stimme sprang an den Wänden entlang wie ein Stein über Wasser. „Ich bin der Schatten selbst! Ich bin unsterblich!“
Valerius fühlte die Kälte in ihren Worten – nicht physisch, sondern wie ein Haken direkt unter dem Brustbein. Sie wollte ihn zweifeln lassen, wollte, dass seine Hand zögerte, bevor sie zuschlug. Doch er sah auch, wie ihre Knie leicht nachgaben, wie ihre Hände zitterten, und wie der Sternenstaub in der Luft sie umschlang wie ein schleichendes Gift.
Die letzte Annäherung
Er ging vor, langsam, als würde der Boden auf seine Schritte warten. Das Amulett in seiner Hand schlug jetzt in perfektem Einklang mit seinem Herzen, und in diesem Rhythmus hörte er die Stimmen seiner Ahnen:
„Nicht aus Hass,“ sagte Theodora, „sondern aus Pflicht.“ „Fester Stand,“ murmelte Roderich. „Lass die Klinge das Urteil sprechen.“
Valerius’ Schritte hallten tief durch die Kaverne. Jeder war ein Nagel im Sarg der Dunkelheit, und er wusste es. Die Schatten an den Wänden zogen sich zurück, zischten, als das Amulettenlicht sie erreichte.
Rumanja hob ihre Hände, spreizte die Finger, und der Abgrund reagierte: schwarze Tentakel aus purem Schatten stiegen empor, wandten sich wie Schlangen auf der Suche nach einem Hals. Das Dröhnen aus der Tiefe schwoll an, füllte die Kaverne, ließ den Stein unter seinen Stiefeln vibrieren.
Der Zusammenprall
„Valerius…“ Ihr Blick bohrte sich in ihn, und nun mischte sich zu Wut und Verzweiflung etwas anderes – eine Spur nackter Angst. „Du verstehst nicht… ich bin mehr als du je begreifen wirst!“
„Und ich,“ antwortete er, seine Stimme fest, „bin mehr, als du je bezwingen wirst.“
Er riss das Amulett hoch, und das Licht brach heraus – nicht als blendender Blitz, sondern als tiefe, unaufhaltsame Welle. Es drang in jede Ritze der Wände, ließ die Runen heller glühen, als würden sie jahrelang angestaute Energie freisetzen. Die Schatten schrien, als hätte man sie in brennendes Öl getaucht, zogen sich zitternd zurück.
Rumanja wankte. Ihre Fersen tasteten den bröckeligen Rand des Abgrunds. Das Dröhnen wurde zu einem Keuchen, der Abgrund sog Luft ein wie in Erwartung einer Gabe.
Valerius trat den letzten Schritt vor. „Du bist nicht unsterblich, Rumanja. Nicht hier. Nicht mehr.“
Das Herz schlägt zurück
Die Höhlen antworteten – ein tiefes, schwingendes Grollen, das vom Boden bis zur dunklen Kuppel rollte. Staub rieselte, lose Steine lösten sich und klackerten in die Tiefe. Ein letzter, schriller Schrei zerriss Rumanjas Kehle. Es war nicht nur der Laut einer Besiegten – es war der Schrei eines Wesens, das wusste, dass selbst sein Name bald nur noch ein Flüstern in vergessenen Gängen sein würde.
Das Herz der Höhlen schlug, einmal, zweimal, im Gleichklang mit dem Amulett in Valerius’ Hand. Und der Abgrund atmete ein.
Kapitel 31: Die letzte Konfrontation
Die Kaverne trug sein Licht wie eine Wunde. Das vereinigte Amulett lag in Valerius’ Händen wie ein Herz aus flüssigem Gold, und jedes Pulsieren schnitt eine weitere Schicht der unnatürlichen Dunkelheit vom Stein. Die Schatten schrumpften, krochen in Risse, als suchten sie eine letzte Nische, um zu überdauern. Überall vibrierte die Höhle – nicht stürzend, nicht kollabierend, sondern zustimmend, als erkenne der Fels an, dass er Zeuge eines Endes war.
Sein Atem war tief und ruhig. Er wusste, dass diese Ruhe nicht ihm allein gehörte. Sie war geliehen von den Stimmen hinter seinen Schulterblättern, von den Händen, die er nicht sah, aber fühlte. Er hörte Theodoras Atem – die klare Strenge darin, die ihn seit Kindertagen aufgerichtet hatte. Er spürte Roderichs knappen, gnadenlosen Takt. Ein Chor aus Blut und Gedächtnis, der sich in seinen Puls schob, ohne ihn zu erdrücken.
Rumanja stand ihm gegenüber. Was einst Majestät gewesen war, war zur Härte eines alten Nagels geworden. Pergamenthaut spannte sich über Knochen, in den Augen glomm ein zähes, hässliches Feuer. Ihre Bewegung war noch immer geschmeidig, aber die Eleganz war fort; was blieb, war die rohe, letzte Entschlossenheit eines Tieres, das den Zaun mit Zähnen testet, obwohl es weiß, dass er unter Strom steht.
„Du bist unsterblich, aber nicht unbesiegbar,“ sagte Valerius, die Stimme fest, unaufgeregt. „Deine Unsterblichkeit hat dich blind gemacht. Sie hat dich hergeführt.“
Der Fels antwortete mit einem Ton, den nur Steine kennen – eine leise, tiefe Resonanz, die wie Zustimmung klang.
Rumanja fauchte. „Ich war vor dir. Ich werde nach dir sein.“ Ihre Worte schabten an den Wänden, sprangen zurück und füllten die Kaverne mit Kopien ihrer Verzweiflung. Dann sprang sie.
Die Klinge im Goldlicht
Sie kam tief und plötzlich, ein raubtierhafter Stoß, die Finger zu Krallen gekrümmt. Valerius trat nicht zurück. Das Amulett brach auf, goss einen Kranz aus Gold zwischen sie. Die Klauen trafen auf unsichtbaren Widerstand, glitten ab, rissen Fetzen aus seinem Ärmel, schrammten Haut, fanden aber keine Tiefe. Ein kurzes, trockenes Lachen entkam ihm – nicht Triumpf, nur Erleichterung, die er sich genau für diese Sekunde erlaubt hatte.
„Noch einmal,“ knurrte Roderich in seinem Kopf. „Beende, was du ansiehst.“
Valerius drehte die Klinge in einem Winkel, den er in keiner Schule gelernt hatte – die Kante knapp über der Parierstange vor, die Spitze niedriger, als wäre sie schwer geworden. Die Bewegung war flacher als ein Hieb, tiefer als ein Streich: das Messer, das man unter eine Wahrheit schiebt. Metall küsste Schatten, stieß auf etwas, das knirschte wie Glas.
Rumanja stolperte, nicht aus Schmerz, sondern aus Überraschung. „Woher—?“
„Er hat es geübt,“ sagte Theodora in ihm, ein Hauch von Stolz, der nicht strahlte, sondern trug.
Runen glühten über den Wänden auf, als wollte die Höhle einen alten Text an die Luft heben. Aus Rissen stieg Staub, fein und süßlich, und der Abgrund in der Mitte – ein schwarzer Schlund mit Zahnreihen aus scharfkantigem Gestein – atmete ein wenig tiefer.
Das Angebot der Finsternis
„Valerius,“ flüsterte etwas, das nicht Rumanja war. Es kam aus dem Schwarz jenseits ihres Rückens, aus dem Raum zwischen zwei Felszähnen. Ein Hauch in seiner Ohrmuschel. „Lass mich. Öffne nur einen Spalt. Ich nehme die Namen. Ich lasse dir die Hände.“
Das Amulett antwortete mit einem flachen, kalten Pochen, als wolle es seinerseits verhandeln. Bilder drängten in sein Blickfeld: ein Dorf, in dem es nie regnet; ein Amboss, der nie kalt wird; Hände, die nicht töten.
„Sie fälschen Quittungen,“ sagte Theodora, hart. „Du schuldest ihnen nichts.“
„Rahme, nicht reiße,“ mahnte eine zweite Stimme, älter. „Gib der Tür Holz, nicht Schwelle.“
Rumanja sah die flüchtige Ablenkung und war wieder vor ihm, schneller als eben. Ihre Finger krallten nach seiner Kehle, und für einen Moment – den kürzesten – war das Goldlicht nicht an der richtigen Stelle.
Er ließ den Schwertarm fallen, nicht nach unten, sondern zur Seite, eine irrationale Bahn, die jeder Lehrer ausgeschlagen hätte. Metall schabte, fand ihre Handwurzel, brach nichts, aber drückte sie fort. Das Amulett sprang auf wie ein Herz aus Licht, und ein goldener Ruck ging durch ihre Glieder. Ihr Schrei war kurz, abgehackt, nicht theatralisch: ehrlich.
„Du hast gelernt,“ flüsterte sie, fast bewundernd, fast.
„Ich erinnere mich,“ sagte er.
Stimmen wie Nägel
Es roch nach kaltem Eisen und altem Wasser. Die Wände schimmerten, als Figuren aus ihrer Haut träten, nur um wieder zurückzusinken: Siegel, Helme, Mündungen von Hörnern, die niemand mehr blies. Die Ahnen standen dichter in seinem Rücken. Es fühlte sich an, als senkten sich mehr Hände auf seine Schultern, an Unterarme, an die Kante seines Kiefers.
„Geh nicht in ihren Rhythmus,“ mahnte Isabetta leise. „Er ist bequemer. Also tödlicher.“
„Zwei Schritte, dann Bogen,“ sagte Roderich. „Nicht länger.“
„Atme,“ sagte Theodora.
Er atmete. Das Gold wurde ruhiger, tiefer, weniger gleißend. Rumanja blinzelte, irritiert von der Änderung, als wäre die Farbe selbst eine neue Taktik.
„Du bist ein Gefäß,“ zischte sie. „Du hast nichts.“
„Ich habe Namen,“ antwortete er und hob das Amulett höher. „Und Namen sind Haken.“
Etwas in der Höhle, das er nicht sehen wollte, nickte. Vielleicht eine Wand. Vielleicht eine Erinnerung, die zu schwer war, um zu fallen.
Der Rand und die Zähne
Sie wichen beide zum Abgrund, ohne es zu wollen. Der Rand war bröselig, doch nicht unberechenbar; die Höhle gab nicht nach, sie wartete. Rumanja drehte sich halb, ihr Profil scharf wie eine Zeichnung. Unter ihnen kroch Kälte herauf, zählte zwischen ihren Atemzügen.
„Du wirst fallen,“ sagte sie. „Oder du wirst mich stoßen. Beides ist armselig.“
„Ich binde,“ sagte er. „Das ist schwerer.“
Sie lachte – kurz, nicht unklug. „Bindest du mich? Oder dich?“
„Uns alle daran, dass es ein Ende gibt,“ sagte er. „Und dass es zählt.“
Sie fuhr wieder auf ihn zu, die Bewegung weicher, falscher, als brachte sie eine Bitte. Seine Klinge hob sich, doch das Amulett war schneller. Ein Schimmer sprang, kein Strahl, eher ein Vorhang. Er sah, wie die Schatten an ihrer Haut schrumpften, als schämten sie sich.
„Valerius,“ sagte sie noch einmal, und in dem Ton lag erstmalig kein Hass. „Gib mir nur… weniger Dunkelheit.“
Er zögerte nicht. „Ich gebe dir das Ende.“ Seine Stimme war nicht hart, nur endgültig.
Das Urteil
Das Amulett öffnete sich, als habe es die Worte erwartet. Kein Blitz, kein Donner. Eher ein Sinken, ein Nachgeben der Luft. Das Gold füllte die Kaverne, nicht gleißend, sondern tief – die Art Licht, die Falten in Gesichtern weich zeichnet und Lügen unmöglich macht. Runen an den Wänden leuchteten mit, nicht in Konkurrenz, sondern im Einklang: Ein Chor ohne Eitelkeit.
Rumanja stolperte, als hätte ihr jemand den Takt weggenommen. Ihre Knöchel knickten ein, die Sehnen an ihrem Hals spannten sich. Ein Schrei baute sich auf – einmal, zweimal –, kam aber nicht mehr als Schrei heraus. Es war eher ein Luftausstoß, überrascht. In ihren Augen flackerte etwas, das aussah wie… Erkennen.
Der Abgrund atmete ein. Der Rand gab nicht nach – Rumanja tat es. Ihr Körper löste sich nicht in Flammen auf, er erlosch. Schatten fielen von ihr wie alte Farbe. Ein feiner Staub brach aus ihrer Haut, silbrig, nicht schwer. Das Letzte, was blieb, war der Blick: rot ohne Leuchten, dann nur dunkel, dann nur Spiegel, der nichts mehr spiegelte.
„Bitte,“ sagte sie ganz leise, so leise, dass er glaubte, es erfunden zu haben. „Nur… weniger.“
„Ich weiß,“ antwortete er, ohne zu wissen, was er damit meinte. „Ich weiß.“
Dann war da kein Körper mehr, nur ein Nachbild, das der Fels nicht behalten wollte. Der Staub sank, träge, fand Ritzen, fand Ruhe.
Die Höhle, die die ganze Zeit geatmet hatte, hielt an. Eine Sekunde. Zwei. Dann setzte ein neuer Takt ein. Nicht fremd, nicht feindlich. Der Boden vibrierte wie ein großes Tier, das beschließt, weiterzuschlafen.
Der Chor fällt leise
Valerius stand, die Klinge gesenkt. Das Goldlicht war da, aber nicht mehr strahlend. Es glomm in seinem Amulett, als hätte es endlich die Größe seines Gefäßes akzeptiert. In seinem Rücken lichtete sich die Reihe. Hände gingen von ihm fort, sanft. Der Druck an seinem Nacken ließ nach.
„Es ist getan,“ sagte Roderich nüchtern, was bei ihm Lob war.
„Es ist begonnen,“ korrigierte Theodora – sanft, was bei ihr ein Kuss war. „Du hast nicht nur beendet. Du hast gerahmt.“
Er kniete. Nicht, weil seine Beine es verlangten, sondern weil der Ort es forderte. Stein gegen Knie, Kälte gegen Haut. Das Amulett war schwer in seiner Hand, aber nicht lastend. Eher wie ein Werkzeug, das fragt: Wo jetzt?
„Was bleibt?“ fragte er leise in die Stille hinein.
„Binden,“ sagte Isabetta. „Nicht mit Blut. Mit Atem.“
„Mit Namen,“ wiederholte er.
Er hob das Amulett und sprach: „Theodora. Roderich. Isabetta. Heinrich. Falkenberg.“ Jeder Name legte sich wie ein Faden in die Luft, unsichtbar, aber spürbar. Die Kaverne nahm sie an, die Runen spiegelten sie, das Gold fädelte sie durch die Risse. Nichts zog sich zu. Nichts explodierte. Es setzte sich nur – wie eine Decke, die geradegezogen wird.
„Und Paris?“ fragte er, und das Wort war plötzlich nah, warm, nach Brot und Regen riechend.
„Atmet,“ sagte Theodora, und er spürte es tatsächlich – ein Echo aus Stein und Straße, das ihn kurz, lächerlich, zum Lachen bringen wollte.
Was das Licht behält
Er stand auf. Die Schatten fielen nicht mehr wie Messer; sie lagen wie Stoff. Der Abgrund war schwarz, aber nicht gierig. Von oben rieselte Staub in ruhiger, ehrlicher Gravitation. Aus einem Seitengang sickerte ein Luftzug, kühl und frisch: der Atem eines Weges.
Valerius hielt das Amulett auf Augenhöhe. Das Gold darin war nun kein Strahlen, sondern ein Glühen – die Sorte Licht, die Wege findet, ohne zu schreien. „Ich trage dich,“ sagte er zu dem Ding, das ihn beinahe gefressen hätte. „Aber du gehst neben mir.“
Es vibrierte, schwach. Zustimmung oder Trotz – schwer zu sagen. Er lächelte, das erste echte seit Stunden, Tagen, Jahren? Zeit hatte hier nie gefallen.
„Mutter?“ fragte er in die Luft.
„Ja, Junge,“ antwortete sie, überall und nirgends. Er hörte Pflaumen und Eisen in ihrer Stimme. „Geh. Der Fels hat genug gehört.“
„Und wenn es wieder klopft?“
„Dann antwortest du,“ sagte sie. „Mit Arbeit.“
Er nickte, lächerlich ernst, wie ein Kind, das eine Aufgabe notiert.
Der Ausgang, der keiner ist
Beim Gehen schien der Gang nicht kürzer zu werden, sondern bereitwilliger. Risse öffneten sich zu Durchlässen, Stufen wuchsen, wo keine gewesen waren. Hier und da ein Geräusch: Wasser, das mühselig tropfte; eine Kette, die nicht mehr klirrte, sondern nur hing; ein Stein, der entschied, heute nicht zu fallen.
Er blieb am einstigen Rand der Kaverne stehen, sah zurück. Kein Drama. Kein Monument. Nur Raum, der wieder Raum sein wollte.
„Es ist vorbei,“ sagte er – für die Höhle, für sich. Die Worte klangen nicht nach Triumph. Eher nach Rechnungsabschluss.
Er ging weiter, und mit jedem Schritt wurde das Gold in seiner Hand ein wenig leiser. Hinter ihm lag kein Blut, keine Spur, nur Staub, der sich gesetzt hatte – mit dem Anstand der Dinge, die genug gesehen haben. Vor ihm – nicht Licht, nicht Ausgang, nur Richtung.
Er war erschöpft. Aber es war eine Erschöpfung, die nicht fraß. Sie setzte sich in die Knochen und sagte: Bleib. Und wenn du wieder gehst, geh.
Valerius legte die Finger fester um die Amulette. Er war kein Überlebender. Nicht nur. Er war ein Rahmen. Ein Wächter, wenn man unbedingt Namen brauchte. Und die Geschichten, die jemals über Licht und Schatten erzählt wurden, mochten sich ändern – aber heute, hier unten, hatte der Stein ein Urteil gesprochen, das nicht in die Luft, sondern in die Wand geschrieben war.
Die Höhle atmete aus. Er tat es auch. Und irgendwo weit oben, so weit, dass es fast lächerlich war, daran zu denken, stand eine Stadt und wusste nicht, warum die Nacht plötzlich normaler roch.
Valerius lächelte in die Dunkelheit, die keine mehr sein musste. „Komm,“ sagte er zu niemand und zu allem. „Wir haben Arbeit.“
Kapitel 32: Der Stoß des Falkenbergs
Die Kaverne von Kandahar hielt den Atem an. Das vereinigte Amulett in Valerius’ linker Hand pochte, als hätte es selbst eine Seele – nicht schnell, nicht langsam, sondern in einem uralten Rhythmus, den nur Blut kennt, das Jahrhunderte getragen hat. Sein Strahlen war kein bloßes Licht. Es war Substanz, Gewicht, eine Präsenz, die die Schatten aus den Winkeln drückte wie Wasser, das Schmutz aus den Ritzen einer Wunde spült.
Die Dunkelheit wich nicht einfach zurück – sie floh, kroch wie verletztes Getier an den Wänden entlang, versuchte, sich in Ritzen zu verkriechen, die es nicht mehr gab. Selbst der Fels hatte aufgehört zu flüstern; er lauschte jetzt nur noch. Jeder Staubkornfall, jedes Knacken tief im Gestein klang wie das Ticken einer Uhr, die bis zu diesem Augenblick gelaufen war.
Die Ahnen im Rücken
Valerius stand aufrecht, den Blick fest. Er spürte nicht nur Theodoras Nähe – er spürte die ganze Reihe. Hinter ihm, unsichtbar, standen sie Schulter an Schulter: Falkenbergs, deren Gesichter er nie gesehen, deren Stimmen er nie gehört hatte, und doch kannte er jeden von ihnen, als hätten sie ihm einst das Brot gebrochen.
„Dies ist der Moment, Junge,“ sagte Theodora in ihm, so klar, dass er sich fast umdrehte. „Kein Zorn. Kein Stolz. Nur Notwendigkeit.“
„Steh fest,“ brummte Roderich. „Lass sie auf dich prallen wie Wellen auf Stein.“
Ein kühler Schauer kroch ihm den Nacken hinab, aber diesmal war er keine Warnung, sondern eine Zusage.
Die Gegnerin im Licht
Rumanja schwankte im goldenen Glanz, den das Amulett ausgoss. Das, was sie jahrhundertelang umgeben hatte wie ein Umhang – diese feste, fließende Nacht – hing jetzt in Fetzen an ihr, löchrig wie verrotteter Stoff. Ihre Augen, einst glühende Kohlen, waren trüb, mit einem mattglänzenden Rest Hass, der eher Erinnerung als Kraft war.
Der Sternenstaub legte sich wie eine zweite Haut über sie, silbrig und kalt. Er sog jeden Versuch auf, sich zu erneuern, jede Regeneration im Keim erstickend. Sie wirkte, als würde jeder Schritt von einer unsichtbaren Hand zurückgezogen.
„Du… wirst… fallen,“ brachte sie hervor, und ihr Ton war mehr das Knirschen von altem Leder als Sprache.
Valerius antwortete nicht sofort. Er ließ sie hören, wie ihre Worte zwischen ihnen verglühten.
Das Schwert
Er hob die Klinge. Das Licht des Amuletts rann wie flüssiges Gold daran hinab, jede Kerbe, jede Rille im Stahl zum Leuchten bringend. Der Griff war warm von seiner Hand, aber in dieser Wärme lag kein Schweiß, sondern Blutgedächtnis – die Summe aller Hände, die ihn vor ihm gehalten hatten.
„Nicht Herz. Nicht Kopf,“ erinnerte er sich. Das waren nur Körperteile. Sie hier war mehr. Und musste an der Wurzel getroffen werden.
Er verschob das Gewicht, spürte den festen Stand, atmete aus. Die Kaverne schien die Luft mitzuhalten.
Der Stoß
Er setzte an, nicht hastig, nicht zögernd – in der unausweichlichen Sicherheit eines Falkenbergs, der weiß, dass dies kein Schlag, sondern ein Urteil ist. Die Spitze fand den Weg unter ihren Rippen, hin zu jenem unsichtbaren Knoten aus Blut, Schatten und Schwur, den sie ihr Leben lang in sich getragen hatte.
Das Amulett in seiner Hand vibrierte im gleichen Augenblick – ein Doppelherzschlag.
Der Laut, der aus ihr brach, war kein Schrei allein. Er war ein Archiv, das in Flammen gesetzt wurde. Das Knacken alter Schwüre. Das Heulen verschluckter Namen. Das Kreischen von Opfern, deren Stimmen sie in sich begraben hatte. Er war Schmerz, aber auch Verlust – der Verlust ihrer ganzen, bitter erkämpften Existenz.
Das Zerfallen
Das Licht brannte durch sie wie Wasser durch dünnes Papier. Ihre Haut spannte sich, riss, ließ Fetzen aus Schatten entweichen, die zischend im Goldlicht vergingen. Ihre Haare wirbelten um ihr Gesicht, als stünde sie in einem Sturm, den nur sie spürte. Ihre Augen füllten sich mit einem Schimmer, halb Licht, halb Asche, und liefen in silbrigen Tränen herab, die noch in der Luft verdampften.
Ihre Hände, die einst Fels hätten zermalmen können, zuckten nur noch in schwachen Reflexen. Jede Bewegung wirkte wie eine Erinnerung an Kraft, nicht wie Kraft selbst.
Die Höhle antwortet
Von oben lösten sich Steine, polterten in den Abgrund. Ein Wind, uralt und modrig, jagte durch die Gänge, riss Staub und alte Gerüche mit sich. Tief in der Ferne erklang das dumpfe Schlagen – als würden Trommeln von Wesen geschlagen, die nie Licht gesehen hatten. Nicht Bedrohung. Eher Anerkennung.
Valerius hielt den Griff fest, bis der letzte Widerstand in ihrem Körper erstarb.
Das Ende einer Ära
Rumanja sackte nicht einfach zusammen. Sie löste sich auf – erst ihre Beine, dann ihre Mitte, bis auch das letzte Flackern ihrer Augen verging. Das, was zu Boden sank, war kein Körper, sondern Staub – feiner, goldener Staub, der im Licht tanzte, als wolle er zum letzten Mal schön sein.
Ihr letzter Laut war kaum mehr als ein Atemzug, aber Valerius hörte darin etwas, das wie Begreifen klang.
„Vorbei,“ flüsterte er, und sein eigener Ton hallte von den Wänden wie ein gesprochenes Siegel.
Nach dem Schlag
Die Luft in der Höhle wurde leichter. Der Druck, der seit seinem Eintritt auf ihm gelastet hatte, wich langsam, als hätte jemand die Fäuste vom Stein gelöst. Das Dröhnen verstummte, der Wind legte sich, und die Schatten blieben dort, wo sie hingehörten – an den Rändern, klein, bedeutungslos.
Das Amulett in seiner Hand glühte sanft weiter, nicht mehr grell, sondern wie eine Glut, die weiß, dass sie bleiben darf.
Valerius sank auf ein Knie. Der Staub unter seiner Hand war kühl und unschuldig, frei von der Bosheit, die ihn Sekunden zuvor erfüllt hatte.
Er hatte den Stoß des Falkenbergs vollführt. Nicht nur, um eine Gegnerin zu töten, sondern um eine Schuld zu begleichen, die Generationen getragen hatten.
Das Vermächtnis war erfüllt. Und die Höhle, die alles gesehen hatte, atmete aus.
Kapitel 33: Der Zerfall
Das Ende kam nicht wie ein Donnerschlag, sondern wie ein schleichendes Ersticken der Welt. Der Schrei, der eben noch durch die gewaltige Kaverne gepeitscht war, brach ab, als hätte eine unsichtbare Klinge die Luft selbst zerschnitten. In diesem Schnitt lag eine so absolute Stille, dass Valerius’ eigener Herzschlag wie ein ungebetener Eindringling wirkte.
Kein Tropfen fiel, kein Kiesel rollte. Die Dunkelheit war nicht einfach Abwesenheit von Licht – sie war greifbar, ein kaltes, zähes Tuch, das sich um seinen Hals legte. Der Stein um ihn herum schien zu lauschen.
Das Gesicht ohne Seele
Rumanja stand noch, aber ihre Augen… Eben noch hatten sie geglüht wie brennende Kohlen, jetzt waren sie erloschen, stumpf, leer wie zwei Stückchen Basalt. Kein Zorn mehr, keine Angst – nur Leere.
Valerius’ Nackenhaare stellten sich auf. Er erkannte dieses Nichts. Es war nicht einfach der Tod einer Kreatur – es war das Aufhören eines ganzen Zeitalters. Die Finsternis selbst hatte einen Blick zurückgeworfen und war dann gegangen.
„Siehst du das?“ flüsterte eine Stimme in ihm. Theodora. Nah wie ein Atemzug. „Ich sehe, dass es vorbei ist,“ antwortete er – und wusste doch, dass er log.
Der Zerfall beginnt
Ihre Schultern sanken, als hätte eine Hand aus dem Abgrund sie hinuntergedrückt. Die Haut löste sich in hauchdünnen Schuppen, fiel zu Boden oder schwebte als graue Fahnen in der Luft.
Darunter das Fleisch, das nicht rot war, sondern die fahle Farbe von altem Wachs. Es riss auf, löste sich auf. Der Leib brach in Wolken aus dunklem Staub, die sich an seine Stiefel schmiegsam legten, als wollten sie mit ihm gehen.
Ein Rauch stieg auf – nicht träge wie Kaminrauch, sondern zielsicher, spiralförmig, mit einer Intelligenz, die man nicht sehen, nur fühlen konnte. Er zog Bahnen, als wolle er jeden Stein dieser Höhle berühren, eine letzte Besitzanzeige, bevor er aufgab.
Die letzte Fratze
Kurz verdichtete sich der Rauch. Die Konturen eines Gesichts formten sich – Rumanjas Lippen, schmal, spöttisch, ein Zucken von Triumph, das in den schwarzen Hohlräumen ihrer Augen sofort zerfiel. Dann riss etwas unsichtbar daran, und das Bild zersprang in flüchtige Schlieren.
„Nicht genug,“ flüsterte es – vielleicht in seinen Gedanken, vielleicht in der Luft. Dann nichts mehr.
Die Reaktion der Höhle
Die Kaverne atmete hörbar aus. Die Wände knackten, als ob Sehnen sich dehnten, Steine rieselten wie Schuppen von einer alten Haut. Aus den oberen Ritzen fielen schwache Strahlen seines Amulettenlichts zurück, als prüften sie, ob der Ort sicher war.
Am Boden lag Asche, fein wie gemahlener Knochen, stellenweise durchsetzt mit schwarzen Krümeln, die wie glimmende Kohle funkelten. Valerius wusste, dass jeder dieser Splitter ein Relikt ihrer Macht sein konnte – zu schwach, um zu handeln, aber zu zäh, um zu vergessen.
Er kniete, ließ die Hand über den Boden gleiten. Kalt. Trocken. Kein Puls. Kein Echo – und doch das Gefühl, dass der Stein zuhörte.
„Vorbei,“ murmelte er, ohne es ganz zu glauben.
Das Flüstern im Fels
Dann, kaum wahrnehmbar: ein Laut. Nicht von außen, sondern aus dem Inneren der Wände. Ein Flüstern wie Wasser, das durch zu enge Ritzen gepresst wird. Keine Worte, nur eine vibrierende Frage: War dies das Ende?
Er spannte sich. Seine Finger schlossen sich fester um das Amulett, das jetzt ohne Strahlen war, aber noch Wärme hielt – die letzte Erinnerung an den Kampf.
„Sie ist fort,“ sagte Theodora in ihm, „aber Dunkelheit stirbt nicht. Sie geht nur.“ „Ich weiß,“ antwortete er. „Und sie vergisst nicht.“
Ein Ort, der nicht schweigt
Die Höhlen von Kandahar standen still, aber nicht stumm. Jeder Stein war jetzt Archiv: der Staub ihrer Existenz, der Geruch nach Schwefel und verbranntem Eisen, der Laut ihres letzten Schreis, der wie feiner Sand zwischen den Fingern verrinnt.
Valerius trat an eine Öffnung im Fels, atmete die stickige, mineralische Luft ein. Vor ihm lag das Labyrinth, seine Gänge wie schwarze Adern, die ins Herz eines Körpers führten, der noch nicht entschieden hatte, ob er lebt oder tot ist.
Er wusste, dass die Schlacht vorbei war. Er wusste auch, dass Schlachten selten das Ende einer Geschichte sind. Licht kann Dunkelheit vertreiben, aber der Schatten behält den Grundriss dessen, was er einmal besaß. Und in diesem Grundriss, tief in den Mauern der Welt, könnte irgendwann etwas wieder aufstehen.
„Dann bin ich da,“ sagte er in den Gang. Keine Drohung, kein Versprechen. Nur ein Fakt.
Er hielt das Amulett so, dass es seine Hand wärmte, und machte den ersten Schritt hinaus aus dem Herzschlag der Höhle – hinein in die Nachwirkungen. Die Dunkelheit hatte verloren. Doch sie hatte Zeit.
Kapitel 34: Die Stille danach
Die Kaverne atmete. Nicht schnell, nicht flach, sondern in tiefen, geologischen Zügen, als hätte der Berg selbst Lungen, die erst jetzt begriffen, dass sie wieder für sich sein durften. Jeder Ausatem trug den Geruch von kaltem Eisen, angebrannter Erde und etwas Süßlichem, das an alte Obstgärten erinnerte, in denen niemand mehr erntete. Die Stille war keine Leere. Sie war dicht, schwer, schichtete sich über den zerklüfteten Boden wie Decken, die jemand sorgfältig auf ein schlafendes Kind gelegt hatte, eines zu viel, damit es auch ja nicht friert.
Valerius’ Knie gaben nach wie Blei, und der Stein nahm ihn ohne Protest an. Er spürte jede Sehne, jeden Muskel, als hätte jemand feine Drähte durch ihn gezogen und sie im Kampf zu hart gespannt. Das vereinte Amulett lag kalt in seiner linken Hand – nicht tot, nicht wach, sondern in diesem Zwischenzustand, den nur Dinge kennen, die zu viel gesehen haben. Kein Glimmen. Nur ein letzter Hauch von Wärme, der an der Handfläche klebte wie der Nachgeschmack eines Namens.
„Es ist vorbei,“ sagte er in die Kälte hinein. Die Worte hingen zwischen ihm und dem Fels, wie Gewänder, die man zum Trocknen aufhängt. Sie wirkten, weil er sie gesprochen hatte – nicht, weil der Stein sie glaubte.
„Für heute,“ korrigierte eine Stimme, sanft und unnachgiebig zugleich.
Er brauchte nicht hinzusehen. Theodora stand nicht dort und stand überall: im Schwung eines Runenstrichs neben ihm, im knappen Reiben von Staubkorn an Staubkorn, in der Art, wie sein Atem zu einem Takt fand.
„Ich weiß,“ flüsterte er. „Aber lass mich einen Moment lügen.“
„Einen,“ sagte sie, und er schwor, der Fels habe genickt.
Das Echo der Ruhe
Der Wind, der eben noch durch Spalten gepfiffen hatte wie ein Messer durch Stoff, war anders geworden. Er trug Töne, die Musiker „Obertöne“ nennen, und die Höhlen „Erinnerung“. Ein sanftes, kaum hörbares Singen, mehr Rhythmus als Melodie, legte sich auf das Schweigen. Valerius schloss die Augen. Das Singen war kein Klang von Menschen. Es war die Art Flüstern, die Höhlen benutzen, wenn sie sich Geschichten erzählen.
Sein Körper meldete sich wie ein aufgebrachter Buchhalter: die Narbe am Unterarm, die jetzt warm pochte; die Schürfwunde an der Kehle, die vom Goldlicht versiegelt, aber nicht vergessen war; die Schultern, müde wie zwei alte Männer, die einen Amboss noch einmal heben. Jeder Schmerz war ein Zettel auf dem großen Stapel, den jemand mit „Bezahlt“ gestempelt hatte.
Er öffnete die Hand. Das Amulett lag auf der Haut wie eine Münze, die man als Kind im Mund getragen hat. Steril, aber mit einer Erinnerung an Wärme. In dessen blanker Fläche sah er keine Engel, keine Dämonen, keine Prophezeiungen – nur sein Gesicht: eingefallen, mit kleinen Staubresten im Bart, die aussahen, als hätten Sterne eine schlechte Nacht gehabt.
„Mutter?“ fragte er in seinem Kopf, nicht in den Raum.
„Ja, Junge.“
„War es genug?“
„Es war Notwendiges,“ sagte Theodora. „Genug gibt es nicht. Nur den nächsten Atemzug.“
Er lächelte, ohne es zu wollen. Der Fels verschluckte das Lächeln nicht; er legte es zu den anderen Dingen, die er sammeln wollte.
Der Staub der Schattenfürstin
Die Luft wurde klarer, Stück für Stück. Doch noch hing der Rauch der Schattenfürstin da, nicht mehr als Macht, aber als Staub, als klebrige Spur, die sich in Falten setzte, in Ritzen, auf Zungen. Überall lagen kleine, schwärzliche Krümel, die unter dem Streiflicht seiner Lampe matt glommen. Es roch beißend – Schwefel, altes Haar, etwas, das man nicht benennen wollte, weil es dann einen Platz in der Welt fände.
Valerius streckte die Hand aus, streifte mit den Fingerspitzen durch die Asche. Sie war feiner als Mehl, lautlos wie Schnee. Ein Teil davon blieb an seiner Haut, als wollte etwas nicht mitgehen, und doch nicht hier bleiben.
„Verbrenn sie nicht,“ riet Roderichs brummender Bass aus der Tiefe seines Hinterkopfs. „Asche, die schon einmal gebrannt hat, frisst ungern Feuer.“
„Was dann?“ fragte Valerius laut, froh, die Stille anzuritzen.
„Rahmen,“ sagte Theodora. „Wie immer.“
Er nickte, obwohl der Instinkt in ihm nach Endgültigkeit schrie, nach Flamme, nach dem großen, reinigenden Nichts. Stattdessen legte er die Hand mit dem Amulett auf den Boden, direkt neben die dunklen Krümel. „Rumanja Katadka,“ sagte er ruhig, nicht spöttisch, nicht feierlich. „Hier endest du. Hier bleibst du. Nicht, um zu warten – sondern, um gehalten zu werden.“
Das Amulett blieb kalt. Kein Licht, keine Geste. Und doch spürte er, wie etwas nachließ – kein Band, eher ein dünnes, unerklärliches Zerren, das einem Splitter im Finger gleicht, den man nicht sieht, aber keine Klinke mehr fassen kann.
Die Höhlenwände antworteten mit einem kleinen, zufriedenen Knistern.
Die Steine sprechen
Er stand langsam auf. Seine Knie schimpften, die Stiefelsohlen klebten einen Atemzug zu lang am Boden, als wollten sie ihn prüfen. Seine Lampe schnitt saubere Keile ins Schwarz. Die Wände waren gesprenkelt von Einschlägen, Schrammen, Schlieren – die Handschrift ihrer Schlacht. Hier eine tiefe, geschwungene Furche, als hätte jemand mit einer riesigen Kralle nach ihm geschlagen. Dort ein Sprühregen aus feinen Kerben, als hätte das Goldlicht Nadeln geworfen. Dazwischen eingelassene Runen – einige alt, mit abgewetzter Geduld; andere frischer, als hätte die Höhle mitgeschrieben.
Er blieb vor einem größeren Block stehen, der aus der Wand zu wachsen schien. Seine Oberfläche war glatt, fast poliert, doch schräg darüber liefen neue Linien, sauber geritzt, kaum tiefer als eine Haut. Bei näherem Hinsehen erkannte er sie als Schrift – nicht seine, nicht ihrer. Die Sprache der Höhle, jene Mischung aus Geometrie und Atem. Drei Striche, ein Kreis, zwei Haken. Er verstand keinen Buchstaben. Aber er verstand gemeint.
„Was steht da?“ fragte er.
Theodora schwieg, und das war Antwort genug. Manche Geheimnisse sind nur für das Material, das sie trägt.
„Ich bin trotzdem nicht beleidigt,“ sagte Valerius und merkte, dass er es tatsächlich nicht war.
Die Gesichter in der Wand
Wenn er weiterging, sah er sie in Wellen: Ausbuchtungen im Fels, Schatten, die kurz zu Augenhöhlen wurden, bevor sie wieder Schatten waren. Manchmal glaubte er Profile zu erkennen — zackige Kinnpartien, hohe Stirnen, Narben, die das Licht mochten. Er blieb einmal stehen, weil die Ähnlichkeit zu stark war, um Zufall zu sein: Ein hoher Wangenknochen, eine Lippenlinie, die nicht streng, aber entschlossen war.
„Vater?“ sagte er, obwohl er wusste, dass der Fels ein schlechter Porträtist ist.
Der Stein antwortete mit Wärme, die keine war. Einmal, nicht zweimal.
„Er hat dich gesehen,“ sagte Theodora, und in ihrer Stimme lag etwas, das man bei Menschen Weinen nennen würde, bei Toten Erinnerung. „Jetzt siehst du ihn.“
„Später,“ murmelte Valerius. „Wir haben Zeit.“
Die Höhle knisterte leise, als schnaube sie, amüsiert.
Das Gespräch mit dem Nichts
Er setzte sich auf einen niedrigen, flachen Absatz, ließ die Beine hängen. Der Abgrund in der Mitte der Kaverne war schwarz wie immer, aber nicht gierig. In regelmäßigen Abständen stieg kalte Luft auf, streifte seine Waden, als wolle sie sagen: Ich bin noch da. Das Dröhnen, das einst wie ein Schlag gewesen war, war zu einem tiefen, beruhigenden Summen geworden, einem Bass, den man eher fühlt, als hört.
„Was bleibt?“ fragte er in die Tiefe.
„Arbeit,“ sagte Roderich prompt.
„Erinnern,“ sagte Isabetta, deren Stimme weich war wie Leder, das man lange getragen hat.
„Atmen,“ sagte Theodora. „Und nicht verkleinern, was groß war, nur weil es vorbei ist.“
Er nickte, trug jede Antwort an den richtigen Platz in sich. Dort, wo man Dinge ablegt, die man später brauchen wird, aber nicht täglich. Das Regal, auf dem die nützlichen Schmerzen stehen.
Der Riss, der nicht heilt
Er folgte dem Gang, der sich aus der Kaverne herauswand. Die Lampe tastete Kanten ab, ließ kleine Spinnen aus Kalk hervorblitzen, die still liegen blieben, als hätte man sie beim Beten ertappt. In der Wand neben ihm lief ein feiner Riss, so gerade, dass er wirken musste wie eine Absicht. Er legte die Finger hinein. Kalt. Dahinter etwas, das wie tiefer Stein war – nicht Luft, nicht Hohlraum. Ein Riss ohne Weg.
Aus diesem feinen Spalt kam ein Hauch. Kein Geruch, kein wirklicher Wind. Eher eine Idee von Bewegung. Er zog die Hand zurück und machte sie wieder fest am Schwertgriff.
„Nur zur Sicherheit,“ murmelte er.
„Einverstanden,“ sagte Theodora. „Vorsicht ist keine Feigheit. Es ist Liebe zum Morgen.“
Er lachte kurz. Die Höhle behielt das Lachen, aber sie gab die Wärme zurück.
Der Gesang des Windes
Der Wind hatte seinen Ton verändert. Zwischen zwei, drei Gängen verschlankte er sich zu einer Melodie, die die Lungen nicht zerschneidet, sondern poliert. Er trug kleine Partikel mit sich, silbrig, die unter dem Licht tanzten, als seien sie die letzten Gäste eines Balles, der viel zu spät endete. Der Sternenstaub, der alles begonnen, alles gebremst und alles beendet hatte, war noch da – aber er war müde. Er setzte sich ab, am Rand kleiner Pfützen aus Schmelzwasser, auf glatte Steine, in seine Fingerkuppe. Er brannte nicht mehr. Er war Erinnerung, die nicht beißt.
„Du bleibst hier,“ sagte Valerius leise zu ihm. „Du bleibst Staub.“
Ein paar Körnchen klebten trotzdem weiter an seiner Haut, als hätten sie etwas vor. Er blies sie weg. Sie schaukelten, entschieden sich für einen Riss, verschwanden.
Die Prophezeiung, die nicht predigt
Er erreichte eine Kammer, kleiner, niedrig, mit einer Decke, die in unzähligen feinen Zacken hing wie der Gaumen eines Ungeheuers. An der hinteren Wand stand ein Relief. Nicht groß. Nicht prahlerisch. Eine Hand voll Linien, die eine Szene ergaben, wenn man müde genug war: Eine Gestalt mit Schwert und etwas Rundem in der Hand; eine andere, die nach hinten fällt; dazwischen Wellen, die nicht wie Wasser aussahen, aber flossen. Am unteren Rand kratzte jemand mit einer scharfen Spitze Zeichen hinein, ungleichmäßig, eilig.
Er hob die Lampe höher. Die Gestalt mit dem Schwert blickte nicht nach vorn, nicht nach unten. Sie blickte zur Seite, dahin, wo nichts eingraviert war. Raum. Möglichkeit. Oder Langeweile mit Absicht.
„Das gefällt mir,“ sagte er.
„Mir auch,“ sagte Theodora. „Prophezeiungen, die Platz lassen, sind höflich.“
„Und selten,“ brummte Roderich.
Valerius legte die Handfläche gegen den kühlen Stein unter der Szene. „Gut gemacht,“ murmelte er. „Nicht zu viel. Nicht zu wenig.“
Der Stein wurde nicht wärmer. Er fühlte sich trotzdem bedankt.
Der Ausgang, der noch keiner ist
Die Gänge wurden breiter. Der Druck auf den Trommelfellen ließ nach, als sei der Berg geneigt, ihm das Aufsteigen zu erleichtern. Hier und da lag Geröll, frisch, kantig; er stieg darüber wie über Gründe, die man noch nicht verstehen kann. In einer Biegung lag ein Knochen – zu groß für eine Ratte, zu klein für ein Rind. Er blieb nicht stehen, um zu fragen, zu wem er gehört hatte. Manche Fragen sind besser, wenn sie nicht gleich Freunde werden.
Seine Lampe fing ein Zucken ein: die feine Bewegung einer blinden Salamanderhaut, die in einer Spalte schimmerte, regungslos, mit der gelassenen Unschuld von Dingen, die kein Interesse an Weltuntergängen haben. Er hob zwei Finger zum Gruß. Das Tier blieb der Höflichkeit treu: Es rührte sich nicht.
„Schau,“ sagte Isabetta. „Leben. Ohne uns.“
„Gut so,“ sagte er.
Der letzte Dialog
Er blieb stehen, hielt das Amulett hoch. Es funkelte nicht, aber es war da. Ein nüchterner Kreis, der nichts versprach und alles behalten hatte.
„Wir zwei,“ sagte er, „werden uns an Regeln halten. Du schlägst neben mir. Nicht in mir. Wenn du wieder anfängst, zu verlangen, wirst du warten, bis ich dich frage. Verstanden?“
Stille. Keine Worte, keine Vision. Nur ein feiner, kaum messbarer Puls gegen seine Haut, wie das Echo eines Echo. Man könnte es Trotz nennen. Man könnte es Zustimmung nennen. Er entschied sich für letzteres. Er hatte heute genug Schwert gehabt.
„Mutter?“ fragte er.
„Ja.“
„Wenn es wieder dunkel wird?“
„Dann wirst du wissen, wie man das Licht leiser macht, statt es lauter zu drehen.“
„Ich… werde es versuchen.“
„Das reicht,“ sagte sie. „Versprechen taugen in Höhlen wenig. Versuche halten länger.“
Er ließ den Arm sinken. Hinter ihm atmete der Berg. Vor ihm lag der Weg, der keiner war: Steig, Knick, Spalt, Stille.
Er tritt hinaus
Als er die letzte große Kammer zurückließ, hatte der Wind aufgehört, Lied zu sein. Er war wieder Luft. Keine Geschichten mehr. Nur Sauerstoff, der seinen Job machte. Die Schatten waren Schatten. Die Steine waren Steine. Und doch war etwas anders, ohne zu protzen: Eine sanfte Ordnung, die die Höhle wie ein aufgeräumter Schrank trug. Man hätte lachen können. Er tat es nicht.
Er blieb am Rand des Tunnels stehen, der nach oben führte, und sah zurück. Die Kaverne lag in seinem Blick wie ein großes, erschöpftes Tier, das man nicht liebte, aber respektieren musste. Es war nichts Heldenhaftes an dem Bild. Und gerade deshalb war es wahr.
„Danke,“ sagte er. Nicht an jemanden bestimmten. Der Berg konnte es sich aufteilen.
Er setzte den Fuß auf die erste Stufe aus Naturstein, die zweite, die dritte. Hinter ihm bewegte sich nichts nach. Vor ihm auch nicht. Die Welt war freundlich banal in diesem Moment. Er trug das Amulett wie ein Werkzeug und das Schwert wie einen Namen.
Die Stille hinter ihm war nicht endgültig. Sie war eine Klammer, die den Satz hielt, bis ein anderer anfing. Und weil er kein Dichter war, sondern ein Schmiedensohn, wusste er, was jetzt kam: Arbeit. Aufräumen. Weggehen, ohne sich zu verstecken.
Irgendwo weit oben – dort, wo Luft das Gesicht streichelt und nicht schlägt – begann eine Glocke zu denken, dass sie bald läuten würde. Paris. Der Gedanke schmeckte nach Teig und Regen.
Valerius hob die Lampe, machte den nächsten Schritt, und der nächste war leichter. Hinter ihm, kaum hörbar, kratzte etwas in den Stein: nicht Drohung, nicht Bitte. Ein Nachhall. Der Berg erzählte schon. Und er wusste, wie diese Geschichten klingen: nicht ganz wahr, nie ganz falsch. Gerade genug, dass die, die zuhören, morgen besser atmen.
„Wir gehen,“ sagte er in die Dunkelheit, die keine mehr sein musste. „Langsam. Und richtig.“
Kapitel 35: Ein Abschied und ein Versprechen
Die Gänge der Höhlen von Kandahar lagen hinter ihm, doch sie hafteten noch an seiner Haut wie feiner Staub, der sich nicht abwaschen ließ. Jeder Schritt auf dem unebenen Fels hallte nach, nicht nur als Geräusch, sondern wie ein Echo, das tief im Brustkorb vibrierte. Der Stein war hier unten nicht tot – er erinnerte sich. An Rumanjas Schreie, an das Aufblitzen des Amuletts, an das letzte Beben, bevor der Schatten zerriss. Jeder Riss in der Wand, jede abgebrochene Stalaktitenspitze war ein stiller Zeuge, ein in Fels gemeißeltes Protokoll seiner Prüfung.
Valerius’ Atem war hörbar schwer. Die Luft trug den metallischen Nachgeschmack der Schlacht, vermischt mit der modrigen Kühle, die aus den tiefsten Kammern strömte. Dort unten war Zeit keine Linie gewesen, sondern ein Kreis, ein endloses Band aus Müdigkeit und Wachen, in dem Tag und Nacht nur noch abstrakte Begriffe waren.
Die Angst, die ihn einst in den Nacken gekrochen war wie ein lebendes Tier, war fort. Sie hatte sich verflüchtigt wie Rauch im Wüstenwind – unsichtbar, aber mit dem hartnäckigen Geruch vergangener Nächte.
Die Stille, die bleibt
Die Höhlen waren still geworden. Keine Tropfen mehr, die von der Decke fielen. Kein Wispern aus den Ritzen, das man für Wind hätte halten können. Es war eine Stille, die den Brustkorb füllte, eine Mischung aus Beruhigung und unterschwelliger Warnung. Er wusste: Ein Rest war immer da. Die Fürstin war gefallen, doch ihre Saat – dieses leise Ziehen am Rande seiner Gedanken – lebte weiter. Ein Hinweis, dass Jagden nicht wirklich enden.
„Du wirst es wieder tun müssen“, murmelte er, ohne zu wissen, ob er es zu sich selbst oder zu der Höhle sagte. Die Wände antworteten nicht – oder vielleicht war Schweigen ihre Antwort.
Der Aufstieg
Der Weg nach oben war mühselig. Jeder Griff in den Fels weckte eine andere alte Wunde. Muskeln brannten, Sehnen spannten sich wie überzogene Bogensaiten. Der Staub der Höhle klebte an ihm, vermischt mit Schweiß und getrocknetem Blut – ein eigenes Wappen, das er erst tragen und dann ablegen würde.
Als er endlich den Ausgang erreichte, war das Licht wie eine Faust. Die Sonne stand tief, aber hell genug, um ihn blinzeln zu lassen, bis Tränen über die Wangen liefen. Er kniff die Augen zusammen, sog die Luft ein – frei, warm, trocken, mit dem Geruch von Sand und ferner Hitze. Es war, als würde er zum ersten Mal seit Jahren atmen.
Durch die Wüste
Die Steppe war weit und flimmerte im Licht. Der Sand gab sanft unter seinen Füßen nach, ganz anders als der scharfe, stechende Stein hinter ihm. Die Wüste war gefährlich, ja, aber ihr Zorn war ehrlich – keine Ranken aus lebender Finsternis, keine Stimmen in den Ritzen.
Nächte in der Wüste waren kühl und voller Geräusche, die nicht drohten: das Zirpen von Insekten, das entfernte Jaulen eines Tieres, der Wind, der sich seinen Weg durch Felsen suchte. Valerius ging mit gleichmäßigem Schritt, sein Schatten lang vor sich her geworfen im Licht des Mondes.
Das Dorf
Nach Tagen erreichte er das Dorf. Häuser aus Lehm, mit flachen Dächern, die in der Sonne glänzten wie aus Gold gegossen. Kinder hielten inne und starrten den Fremden an; ihre Mütter zogen sie sanft beiseite, nicht aus Misstrauen, sondern aus Respekt vor der Müdigkeit, die dieser Mann ausstrahlte. Alte Männer vor den Türen nickten ihm zu – kleine Gesten, wie Gebete, die man nicht laut spricht.
Er blieb. Trank Wasser, das nach Erde schmeckte, aß Brot, das nach Rauch duftete. Jeder Bissen holte ihn ein Stück weiter aus der Dunkelheit. Doch er wusste, das war nur ein Rastplatz.
Das Begräbnis des Amuletts
An einem Abend, als die Sonne sich blutrot in den Sand senkte, ging er zu dem einsamen, knorrigen Baum am Rand des Dorfes. Dort begann er zu graben. Die Erde war hart, doch seine Hände kannten keine Ungeduld.
Das Amulett, kühl und schwer, lag in seiner Hand. Er sah hinein – oder glaubte, hineinzusehen – und meinte, ein letztes Aufblitzen zu sehen. Kein Zorn, kein Hunger. Vielleicht Anerkennung. Vorsichtig legte er es ins Loch, schob Sand und Erde darüber, bis kein Glanz mehr zu sehen war.
„Du bleibst hier, bis man dich wieder braucht“, sagte er leise. „Und wenn dieser Tag kommt… werde ich da sein.“
Das Versprechen
Er blieb hockend, die Hände auf der frischen Erde. Über ihm ein Himmel, so klar, dass die Sterne wirkten wie Löcher in einer perfekten Decke. Jede Sternenspitze schien zu ihm zu schauen. Er dachte an Theodora. Sah ihr Gesicht zwischen diesen Lichtern, hörte ihre Stimme: „Die Dunkelheit vergisst nicht. Also tu du es auch nicht.“
Ein Gefühl von Frieden kam – und gleich darauf der Schatten einer Ahnung: dass dies nur eine Pause war. Kein Ende.
Er richtete sich auf. In der Ferne summte die Wüste im Abendwind. Er straffte die Schultern, der Blick fest auf den Horizont. „Ich werde bereit sein“, sprach er, mehr zum Wind als zu sich selbst.
Der Wind nahm die Worte auf, trug sie davon. Vielleicht zu Orten, an denen sie gebraucht würden.
Valerius von Falkenberg, Jäger, Sieger, Wächter – ging weiter. Der Sand gab nach unter seinen Füßen, und irgendwo, hinter den Dünen, war schon der nächste Schatten geboren. Die Stille, die ihn jetzt umgab, war nur ein Atemholen der Welt zwischen zwei Stürmen.
Kapitel 36: Die Last der Vergangenheit
Die Rückkehr nach Europa fühlte sich für Valerius an wie das Durchschreiten einer dünnen, unsichtbaren Membran – als hätte er eine lange Reise nicht nur durch Kontinente, sondern durch Zeit, Tod und Erinnerung hinter sich gelassen. Der Geruch war anders. Hier roch es nach nassem Stein, nach Moder und dem fernen Duft von Brot aus einer Bäckerei, die er im Dunkeln erahnen konnte. Die Straßen, die er als Kind entlanggelaufen war, lagen vor ihm wie eingefrorene Bilder aus einem Traum: Kopfsteinpflaster, von Generationen glatter Füße abgenutzt, Laternen, deren Metallrohre Rostnarben trugen, als hätten sie Kriege überlebt.
Doch er selbst war ein anderer geworden. Die Schwere in seinen Augen ließ sich nicht ablegen wie ein abgewetzter Mantel.
Das Anwesen
Das Falkenberg-Anwesen stand vor ihm, so vertraut, dass es ihn fast blendete – und zugleich fremd, als wäre es inzwischen jemand anderem anvertraut. Die hohen Türme und die dunklen Schieferdächer reckten sich gegen einen wolkenverhangenen Himmel. Efeuranken klebten an den Mauern wie alte Geheimnisse, die nicht loslassen wollten.
Als er das Tor passierte, schien ein kalter Hauch an seinem Nacken zu streifen. Kein Wind – nur die Gegenwart von Steinen, die zu lange geschwiegen hatten.
Innen war es, als atmete das Haus ihn ein. Die schweren Eichentüren schlossen sich mit einem Laut, der in den hohen Hallen hängen blieb. Staub tanzte in den Lichtkegeln, die durch die hohen Fenster fielen, und jedes Körnchen schien eine Geschichte zu tragen.
Die Wände waren verkleidet mit dunklem Holz, durchzogen von Rillen, in denen sich die Wärme vergangener Feuer verkrochen hatte. An manchen Stellen spürte er die Kälte des Steins darunter, wenn er mit den Fingern darüberstrich.
Die Bibliothek der Mutter
Er fand sie dort, wo er es ahnte: die Bibliothek. Der Geruch von altem Pergament und Leder umfing ihn wie ein Mantel. Regalreihen, so hoch, dass man eine Leiter brauchte, standen Schulter an Schulter wie Soldaten, die Wache hielten.
Auf dem zentralen Tisch lag ein Stapel Manuskripte, so ordentlich, dass es fast trotzig wirkte – als hätte jemand geahnt, dass er eines Tages zurückkehren würde.
Er zog das oberste Buch zu sich, hörte das leise Knacken des Leders. Die Seiten waren brüchig am Rand, mit einer feinen Patina von Zeit. Zwischen den Seiten entdeckte er Briefe.
Seine Mutter schrieb, als würde sie direkt vor ihm sitzen. Ihre Handschrift war fest, klar, kein Zögern. Mein Sohn, das Erbe, das du trägst, ist schwer. Aber in jeder Generation gibt es einen, der es tragen muss. Er hörte ihre Stimme, den Unterton von Zärtlichkeit unter der Strenge. Fürchte die Dunkelheit nicht – aber verachte sie auch nicht. Sie wird immer irgendwo leben. Dein Auftrag ist nicht, sie für immer zu töten, sondern ihr das Wachsen schwer zu machen.
Er las weiter, und je mehr er las, desto mehr zogen ihn die Worte hinein, als stünde er wieder am Herd in der alten Küche, der Duft von Apfelkuchen in der Luft, während sie ihm erklärte, wie man das Schwert hält, ohne dass die Hand ermüdet.
Die Leere nach dem Krieg
Doch die Ruhe nagte an ihm. Der Feind war besiegt. Die Kaverne versiegelt. Kein neuer Name auf der Liste. Ein Jäger ohne Beute ist wie ein Hund ohne Rudel, dachte er. Ein Krieger ohne Krieg – nur noch ein Körper, der auf Bewegung programmiert ist, ohne Ziel.
Die Nächte waren am schlimmsten. Im Dämmerzustand hörte er das Echo von Rumanjas Schrei, sah den schwarzen Rauch spiralförmig steigen. Manchmal erwachte er, weil er glaubte, ihre Krallen über den Dielen zu hören. Schweiß klebte an ihm wie eine zweite Haut.
Er begann, stundenlange Runden durchs Haus zu drehen. Seine Schritte hallten durch die Korridore, vorbei an den Porträts der Ahnen – harte Gesichter in Öl, deren Blick ihm folgte.
„Bin ich euch würdig?“ fragte er einmal halblaut. Die Stille war die Antwort. Aber er meinte, im Knacken der Holzbalken etwas zu hören – nicht Zustimmung, nicht Ablehnung. Nur Geduld.
Die Doppelbelastung
Er war zwischen zwei Welten gefangen. Diese Mauern gaben Sicherheit, doch seine Sinne waren auf Gefahr getrimmt. Jedes Knarren ließ ihn zur Seite fahren. Das Pfeifen des Windes an den Fensterläden war wie ein Ruf aus den Höhlen.
Er wusste, dass er wachsam bleiben musste, denn Dunkelheit war wie Wasser: Sie sucht sich immer einen neuen Weg. Aber er musste auch lernen, wieder zu leben. Mensch zu bleiben.
Die Abende verbrachte er in der Bibliothek, studierte alte Karten, zeichnete Linien, die zu Orten führten, an denen sich das Böse wieder regen könnte. Nebenbei las er die Randnotizen seiner Mutter – kurze Sätze, manchmal nur ein Wort. "Warten." "Schauen." "Niemals in Eile."
Morgengrauen über Falkenberg
Eines Morgens, der Nebel hing noch tief über den Feldern, stieg er auf den höchsten Turm. Unter ihm erstreckten sich Wälder wie eine unbewegte See. Der Geruch von feuchter Erde und nahendem Regen stieg zu ihm hinauf.
Er ballte die Fäuste, spürte die Kälte im Griff, schloss die Augen. „Ich werde bereit sein. Immer“, flüsterte er – nicht als Wunsch, sondern als Schwur.
Die Schatten der Vergangenheit würden nie ganz weichen. Aber er war kein Mann mehr, den sie erdrücken konnten. Er war Valerius von Falkenberg – Jäger, Überlebender, Wächter. Und auch wenn irgendwo, vielleicht jetzt schon, die Dunkelheit wieder atmete, wusste er: Diesmal würde sie nicht unbemerkt kommen.
Kapitel 37: Eine neue Berufung für Valerius zum Schutz der Menschheit
Die ersten Tage nach der Rückkehr ins ehrwürdige Anwesen der Falkenbergs waren wie das Erwachen in einem fremden Haus, das zugleich Heimat und Prüfstein war. Die Stille dort war keine willkommene Ruhe; sie war vollgestopft mit Erinnerungen, mit dem dumpfen Nachhall von Stimmen und Gesichtern aus einer Zeit, in der er noch glaubte, die Dunkelheit habe ein Ende. Der lange Korridor hinter dem Eingangsportal roch nach kaltem Stein und Wachs. In den hohen Fenstern hing der Nebel wie matter Hauch. Die Ahnenporträts entlang der Wände waren mehr als bemalte Leinwand – ihre Augen folgten ihm. Manchmal glaubte Valerius, ein kaum hörbares Murmeln zu vernehmen, ein Wispern in einer Sprache, die älter war als das Haus selbst.
„Du siehst… älter aus“, meinte eine Stimme in seinem Rücken, warm und streng zugleich. Theodoras Stimme. Er drehte sich nicht um – er wusste, dass er dort nur Schatten sehen würde.
„Die Höhlen… nehmen mehr, als sie geben“, antwortete er leise, und die Wände schienen das Wort „geben“ wie eine Frage zurückzuwerfen.
Die Warnung der Bruderschaft
In der Bibliothek fand er den alten Brief der Bruderschaft des Löwen wieder, das Pergament spröde, die Tinte wie getrocknetes Blut. Er strich über den Siegelabdruck – ein stilisierter Löwenkopf, dessen Augenhöhlen hohl und doch allsehend wirkten.
„Das Böse verschwindet nie. Es schläft nur. Und eines Tages wird es erwachen, um erneut nach euch zu greifen.“
Diese Zeilen hatte er früher wie eine Mahnung gelesen, jetzt waren sie eine Gewissheit. Rumanja war nur die Fassade gewesen. Unter der Oberfläche lag ein Netz aus Finsternis, verzweigt und uralt.
Die Entscheidung
Er ging lange im Kerzenschein auf und ab, bis er es in Worte fassen konnte: „Ich kann nicht allein bleiben. Ich muss… weitergeben.“
Der Entschluss wurzelte tief. Seine Aufgabe würde nicht länger nur das Jagen sein, sondern das Lehren – Schutz nicht durch einsame Klingen, sondern durch viele wachsame Augen. Er richtete im Ostflügel Räume her, ließ die verstaubte Fechthalle ausräumen, den alten Schießstand wieder instand setzen. Die Bibliothek erhielt einen neuen, hellen Saal, in dem nicht nur Pergamente lagerten, sondern auch Karten, Berichte, Chroniken von Jägern vergangener Jahrhunderte.
Auf Reisen
Wochen später verließ er das Anwesen, zog hinaus in Wälder, über Gebirge, durch verlassene Klöster und sumpfige Ebenen, suchte junge Menschen mit wachen Blicken und schweren Herzen. In einem kroatischen Bergdorf fand er Marek, einen Schmiedesohn, der sich nachts allein ins Moor wagte, um das Licht alter Grenzfeuer zu prüfen. In Irland begegnete er Aoife, deren Familie seit Generationen von einer Kreatur heimgesucht wurde, die nur sie sehen konnte. Er setzte sich zu ihnen ans Feuer, erzählte – nicht prahlend, sondern warnend – von Rumanja, den Höhlen, von Dunkelheit, die nicht in Märchen gehörte. Manche hörten zu und wandten sich ab. Andere blieben.
Aufbau einer Gemeinschaft
Bald füllte sich das Anwesen mit Stimmen, Schritten, dem metallischen Klang von Klingen, die an Schleifsteinen gezogen wurden. Im Hof hallten Kommandos, in den Gängen roch es nach Schweiß und Eisen. Valerius beobachtete, wie manche in der ersten Nacht zusammenkauerten, von Albträumen gejagt – und wie sie Monate später selbständig Wachtouren übernahmen. „Es ist nicht der Kampf allein“, sagte er einmal in einer Abendstunde zu seinen Schülern, „sondern das Wissen, wann er beginnt. Die Dunkelheit gewinnt, wenn wir sie nicht erkennen.“
Jahre später
Die Bibliothek schwoll an wie ein Herzmuskel. Regale füllten sich mit neuen Bänden, Berichte aus allen Teilen Europas. Die Namen seiner ersten Schüler kehrten als Ausbilder zurück. Bedrohungen blieben – geformt aus neuem Hass, aus alten Flüchen –, doch nun gab es Ketten von Wächtern, nicht nur einen.
Abends, wenn die Sonne lange Schatten über den Westflügel warf, saß Valerius oft am großen Eichentisch, die Hände um eine Tasse schwarzen Tees, während draußen auf dem Hof das dumpfe klack-klack der Holzschwerter klang. In diesen Momenten dachte er unwillkürlich an Rumanja. Nicht mit Triumph, sondern mit klarem Blick: Sie war Mahnung und Maßstab zugleich.
Das Vermächtnis
Sein Haar wurde grau, die Bewegungen langsamer, doch seine Präsenz schärfer denn je. Er war nicht mehr der einzelne Jäger in der Nacht, sondern der Leuchtturm, um den sich viele kleine Flammen versammelten. Die Flure trugen seinen Namen. In den Schlafsälen hing sein Wappen – ein Falke über einem Lichtkreis. Die jüngeren nannten ihn „den Hüter“, nie „den Meister“.
„Und wenn sie zurückkehrt?“, fragte Marek eines Abends leise.
Valerius sah lange in die Glut im Kamin. „Dann wird sie uns nicht finden, wie sie uns will. Sie wird eine Mauer sehen – und jeder Stein darin wird ein Herz sein, das gelernt hat, nicht zu weichen.“
Am höchsten Punkt des Turms, die Hände auf der Brüstung, blickte er oft über Felder und Wälder. Die Dunkelheit würde wiederkehren, in anderer Gestalt, mit anderer Stimme. Aber er – und jene, die er gelehrt hatte – würden da sein.
„Immer bereit“, sagte er in den Wind.
Und irgendwo in der Tiefe der alten Mauern schien ein leises, zustimmendes Wispern zu antworten.
Ende
Copyright © by Michael (Gecko) Mahler