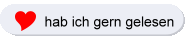Veröffentlicht: 27.02.2024. Rubrik: Unsortiert
Jaromìr
„Bitte, nenne mich bei meinem wahren Namen!
Damit ich all mein Weinen und Lachen zugleich hören kann.
Damit ich sehe, daß meine Freude und mein Schmerz eins sind.
Bitte, nenne mich bei meinem wahren Namen!
Damit ich erwache!
Damit das Tor meines Herzens von nun an offen steht,
das Tor des Mitgefühls."
-
Bitte, nenne mich bei meinem wahren Namen
- Tich Nath Hanh
***
Die Stille lärmt in meinem Kopf, als ich erwache. Der Mond scheint hell und weit und dringt kaum durch den dicken Vorhang mit dem verblichenen Aquarellmuster zu mir durch, hinter dem sich weite Wiesen ausdehnen. Etwas desorientiert und mit einem Stechen im Magen liege ich in dem fremden Zimmer und fühle Beklemmung angesichts einer bevorstehenden Prüfung und der Fremde, in der ich mich befinde. Spät am Abend, vor wenigen Stunden erst, bin ich nach meiner Reise in überfüllten Zügen quer durch das Land hier angekommen. Und kurz nachdem die Verwalterin mir das hübsche, rustikale Apartment gezeigt und sich verabschiedet hat, bin ich schon erschöpft ins Bett gefallen.
Rund um mich ruht still der Gebirgsausläufer mit seinen Wäldern, Wiesen und Almen, die Luft ist frisch und klar und duftet nach saftigem Grün und gerade Erblühtem. Wenn Morgen alles überstanden ist, werde ich mich ausgiebig umsehen, bevor ich abreise. Ich seufze und bringe es nicht über mich, die warme Decke zu verlassen, um zwei Räume weiter zu gehen. Ich sehe auf mein Handy nach der Uhrzeit. Es ist viel zu hell und ich sehe wieder weg. In wenigen Stunden soll ich die letzte große Prüfung für einen Ausbildungsabschluss ablegen, der mein berufliches Fortkommen bestimmen wird. In meinem Magen flattert wieder jener Vogel, der sich so schwer beruhigen lässt, und mein Kopf rotiert in alten, abgewetzten Kreisen und dornigen Irrwegen, in denen ich mich immer wieder verirre. Seit Tagen begleitet mich das Stechen im Magen, zusammen mit heimtückischen Fragen, wie: „Was, wenn es schief geht?“
Wenn ich nicht bald schlafe, wird es genauso kommen. Der Druck peitscht die Nervosität auf und ich versuche, mich mit dem Gedanken daran abzulenken, was für ein Glück ich gehabt habe, angesichts des kurzfristig bekanntgegeben Prüfungstermins eine so passable Unterkunft gefunden zu haben. Doch es bringt nichts. Und wie gut ist die Reise verlaufen, in der alles Mögliche hätte schief gehen können? Wenn ich soviel Glück habe, warum bin ich dann so verdammt nervös? Hilflos angesichts der Unruhe und genervt von meinem Bedürfnis, schlage ich schwungvoll die Decke auf die andere Seite. Wenn morgen doch schon vorbei wäre! Was mir bleibt, ist die stoische und leidenschaftslose Gewissheit, dass irgendwann alles vorbei ist. Das habe ich gelernt. Die Laken leuchten so hell, wie meine Haut, und ich erahne das Blumenmuster der Bezüge. Sie riechen frisch gewaschen und sauber. Ich verfluche die Natur, während ich das dunkle Quadrat der offenen Tür im seichten Mondlicht ausmache, wie ein Portal.
Als meine Hand mit dem Schwung auf ein Hindernis stößt, gefriere ich zu Eis. Blitzschnell ziehe ich sie zurück und halte inne. Da war gestern noch nichts, die andere Seite des Doppelbettes war leer. Nun bin ich vollkommen wach.
Habe ich den Koffer dort hingelegt? Eine zweite Decke? Nein, habe ich nicht. Mein Herz rast.
Mir wird ganz kalt. Hat sich jemand aus einem anderen Apartment dort hingelegt? Warum hat er mich dann nicht gesehen? War er betrunken? Oder bin gar ich am falschen Ort? Ich beruhige mich mit dem Gedanken, dass mich die Vermieterin selbst hereingelassen hat. Mit ihrem kleinen Hund. Sie hatte einen Hund. Ich halte mich daran fest, wie an einem Strohhalm, während mich alles andere aus meiner Realität fortreißen will. Angestrengt versuche ich, mich auf die schauerliche Erhebung zu konzentrieren. Mein Bedürfnis ist vergessen. Ich denke daran, dass Rehe im Scheinwerferlicht gefrieren und verstehe, warum. Wie lange ich so dasitze, starr, abseits der Zeit und mit einem so laut klopfendem Herzen, dass ich bete, dass es niemanden wecken wird, weiß ich nicht, ich strenge mich nur an, ganz still zu sein.
Eine grausam penetrante Ahnung in mir will herausfinden, was dort ist. Ich nicht. Vielleicht habe ich mir das Hindernis eingebildet oder wirklich vergessen, dass ich dort etwas hingelegt habe. Ich kralle mich an der Logik fest, die mir jedesmal entgleitet, versuche, mich an einer Welt festzuhalten, die ich kenne, an der morgigen Prüfung, den Wiesen und meiner Reise, und bete mir vor, was mich seit Monaten quält. Mit aller Macht versuche ich es, jedoch vergeblich. Vielleicht holen die Schatten der Nacht Verborgenes aus uns hervor, das am Tage nicht sichtbar sein kann. Ich jedenfalls höre nun Geräusche, die vielleicht nicht da sind, bis meine Ängste ihre Grenzen übertreten und ich wissen muss, was dort drüben ist. Ein Blitz fährt in mich, als ich die Erhebung erspüre und ich schaffe es nur unter größter Anstrengung, meine Hand ruhig zu halten. Kurz besinne ich mich und befühle harten Stoff, feste Falten und Unebenheiten, einen Bund. Keinen Koffer, keine Decke. Dafür einen Ärmel und dann … eine Hand.
Mit einem Schrei ziehe ich mich zurück. Mein Puls hämmert so laut in die genügsame Stille der Nacht hinein, dass mein Körper auf der Matratze vibriert. Eine Hand. Eine kalte Hand. Das Adrenalin in mir verlangt dass ich fliehe. Sofort. Doch als ich dazu ansetzen will, packen mich die verräterischen Krallen der Angst: Was, wenn er aufwacht? Ich bin wie gelähmt. Aber, hallt es kleinlaut durch meine Gedanken, ich habe mich bereits bewegt und ihn berührt. Mein Körper zittert ohne mich, macht, was er will.
Was, wenn er nicht lauert? Ich kann nicht sagen, ob das schlimmer ist. Auch kann ich das Licht nicht einschalten, da mich eine Paralyse im Angesicht von Ahnungen festnagelt, die ich nicht verstehe. Irgendwann bringt mich die zunehmende Entrückung dazu, hinüber zu blicken. Die Umrisse der Erhebung - des Körpers – werden aufgefangen vom verhüllten Mondlicht. Und sie atmen nicht. Der nächste Schauder füttert meine Zerrüttung und ich kann nicht in meinen Kopf lassen, was nicht hineinpasst. Ich unterdrücke das Wimmern, das mir im Halse steckt und blicke nochmals hinüber. Die Umrisse sind deutlicher und als ich einen menschlichen Körper erkenne, bleibt mein Herz beinahe stehen. In diesem Moment nehme ich einen Geruch wahr, der mich in etwas übertreten lässt, dass mich beruhigt. Ja, dort liegt ein Mann. Ich versuche vorsichtig, sein Gesicht zu erkennen, doch kein Aufblitzen und keine Reflexion ist dort, wo seine Augen sind, keinerlei Regung. Sie fehlt so, wie sein Atem. Der Mann ist groß und nicht wach. Und er schläft nicht.
Mein Herz stolpert vor Wehmut und ich erkenne nun den Geruch, ohne ihn wirklich zu kennen. Der Mann riecht wild und schwer, nach nassem Erdboden, fremden Gewürzen und frisch gehacktem Holz, auch ein bisschen, wie der Boden im Garten meiner Großeltern. Und ich rieche noch etwas: Eisen.
Der Impuls, wegzurennen, wird übermächtig und gleichzeitig weiß ich, dass ich bleiben muss. Ich kämpfe mit mir, ertrage seine Anwesenheit nicht und kann doch nicht von ihr weg. Ich ächze und schaue schnell, ob er darauf reagiert. Nichts. Erleichtert und enttäuscht höre ich einen Gedanken in diese neue Realität kriechen, wie eine Schlange, die flüstert:
„Was, wenn er nur darauf wartet, dass du wegläufst?“
Ich kann nicht mehr atmen, verliere mich zwischen den Vögeln in meinem Magen und fühle mich so ausgeliefert, wie nie zuvor. Gehetzt blicke ich zu meinem Handy, es wirkt surreal hier und ich wage nicht, es zu aktivieren. Ich habe Angst, ihn zu wecken, wohlwissend, dass das nicht passieren kann. Zerrissen zwischen den Möglichkeiten weine ich. Ich möchte weg von hier und nichts mit alldem zu tun haben! Doch mein Körper kann die unsichtbaren Fäden nicht abschütteln, in denen er hängt, wie eine Marionette. Der Geruch nach Eisen verursacht mir Übelkeit und meine Gedanken spucken scheinbar wahllos Bilder aus, die ich nicht sehen will. Bilder von Blut und großen Verletzungen. Mit einem Mal fährt mein System herunter, und ich werde ganz ruhig. Mit Augen, die sich immer besser an die Dunkelheit gewöhnt haben, betrachte ich abermals die Gestalt. Sie schimmert gefährlich an Kopf und Körper. Wenn das Blut ist, dann ist es viel Blut.
Als die tanzenden Flammen zweier Kerzen tauchen vor meinem geistigen Auge auftauchen, wird mir reichlich schwindelig. Ich höre ihr kleines Feuer leise in der umgebenden Luft knistern, wie ein altes Geheimnis. Darunter erscheint der abgewohnte Tisch eines kleinen Holzhauses, das mir heimatlich vertraut ist, in dem ich aber noch nie gewesen bin. Der Raum führt auf einen breiten, steinernen Kamin hin, den ich gerade betrachte, als alles wieder verschwindet.
Ich befinde mich wieder neben dem Mann und bin ganz ruhig, leer geradezu. Ich blicke zum Fenster und rechne mir die Chancen aus, hinauszuklettern, um schnell von hier wegzukommen. Doch aufstehen und zu schauen, ob ich dort hinaus käme, käme dem gleich, was ich vermeiden will. Aufmerksamkeit.
Überdies weiß ich längst, dass er mir nicht folgen wird, dass ich nicht mehr weglaufen muss. Ich weiß mehr, als ich mir eingestehen kann. Noch immer liege ich da, doch es hat sich alles verändert. Ich sehe ihn an und denke an die Kerzen, an das knistern. Ich kenne das Holzhaus. Gut sogar.
Das Schimmern auf seinem Körper und in seinem weißen Haar weckt einen Verlust in mir, dessen Maßlosigkeit ich mit nichts, das ich kenne, in Verbindung bringen kann. Und die langsam einsetzende bleierne Wehmut führt dazu, dass ich mir langsam selbst entgleite. Sein Gesicht ist mir vertraut. Nicht die verkrampften Züge, aber die Falten und die Züge darunter, in die das Mondlicht gleichmütig seine Schatten legt. Er sieht alt aus, älter, als er ist, höre ich in meinem Kopf, ohne es zu denken.
Warum glaube ich nicht mehr, dass er Gefahr für mich ist? Woher die Zuneigung? Werde ich verrückt? Seit ich das Haus gesehen habe, durchquert mich etwas wie der Geist einer uralten Erinnerung, die doch noch da ist.
Struktur und Gewebe seiner Kleidung erinnern an nichts, das heute noch hergestellt wird. Sie fühlen sich an, wie eine Rüstung, so dass ich mich noch kleiner und hilfloser fühle. Sie riecht muffig und süßlich, nach Erde und verbranntem Holz, und nach Blut. Es schüttelt mich, als zöge sich eine Gänsehaut über meine Seele. Das Gefühl der Entrückung wird stärker und ich merke, dass etwas wiederkommt, das nichts mit mir zu tun hat. Meine Reise, das Apartment, die Prüfung, und die Flucht könnten weiter weg nicht mehr sein.
Ich befinde mich in dem Holzhaus mit dem stummen Kamin, sehe roten Steinboden und die beiden flackernden Kerzen. Frierend und hungrig wie immer höre ich gedämpfte Schritte auf der anderen Seite der Holzwände, durch deren Ritzen der Wind pfeift. Mit ihrem Näherkommen wächst meine mühsam im Zaum gehaltene Beunruhigung, ich horche angestrengt und kann erst ausatmen, als sich mit leisem Quietschen die Türe öffnet. Denn da sehe ich ihn. Durch die Tür tritt jener Mann, der in einer anderen Welt neben mir im Bett liegt. Er trägt dieselbe Jacke, sie ist braun. Ich erkenne sein Gesicht und seine Augen, sie sind auch braun. Wie meine. Geschickt balanciert er einen Stapel faseriges Feuerholz auf dem Unterarm, dreht sich mit gebeugtem Rücken um und schließt leise die Tür. Weiße Schneeflocken wehen ins Haus, wie kalte Zeugen der rauen Wirklichkeit, die er damit aussperrt.
„Heute können wir ihn anbrennen“, sagt er in einer Sprache, die ich nicht kenne, aber verstehe. Sein warmes, faltiges Lächeln erhellt die Sprachlosigkeit unseres Alltages, bevor die Szene wieder geht.
Ich liege im Apartment und mir ist schwindelig. Ich bin aus Raum und Zeit gefallen und die Leichtigkeit und Schwere, die das Haus in mir weckt, lässt mich mit dem Wissen zurück, dass ich hier nicht mehr hingehöre. Was ich gesehen habe, war größer und echter, als alles in meinem hiesigen Leben. Größer als ich. Ich friere und freue mich über den bescheidenen Stapel Brennholz, doch jeder Muskel in mir verspannt sich beim Gedanken daran, wieder dorthin zu gehen. Die Widersprüchlichkeit dieser diffusen Bedrohung macht mich atemlos, und als sie sich mir erklären will, verstehe ich ihre Sprache nicht. Ich weiß nur, dass ich hierbleiben will. Unwissend. Ahnungslos.
Ich lege die Decke über meinen Körper, um mich zu wärmen, doch es funktioniert nicht. Statt dessen quält mich die Erwartung des wärmenden Feuers eines Kamins, der einmal der Mittelpunkt einer Welt gewesen war. Meiner Welt. Wie ein gemeiner Dieb schleicht die Enttäuschung durch meinen Geist, während ich die Decke noch höher ziehe. Ich verstehe nicht, warum es das einzig Richtige ist, mich hier hinzulegen, neben ihn, doch ich tue es. Ich hinterfrage nichts mehr. Etwas hat mich im Griff und ich lasse es gewähren.
Beklommenheit verknotet mir das Herz und will festen Widerstand gegen die beginnende Wehmut bieten, und darum herum tanzt mühsam die Angst. Mit geschlossenen Augen konzentriere mich auf den beruhigenden Geruch des Mannes.
Und ich bin wieder in Haus. Der Mann kniet vor dem Kamin. Er hat lange gebraucht, um sich niederzuknien und ich höre, wie er mit bedachten Bewegungen und steifen Händen die Glut zwischen den Steinwänden entfacht. In froher Erwartung und Dankbarkeit verfolge ich jeden seiner Handgriffe und als ich noch den schweren Geruch des Entzündens rieche, pustet er schon auf die ersten, zögerlichen Flammen. Bald breitet sich eine wunderbare Wärme im ganzen Raum aus, beleuchtet das Holz der Wände und Möbel und macht daraus jene goldene Magie, die ich seit Kindertagen so liebe. Mit Erinnerungen an frohe Geschichten und vertraute Gesichter im glühenden Schein erfüllt und tröstet sie meinen alten Körper. Sehr langsam und gebeugt stellt der Mann zwei Stühle vor den Kamin. Sein schwerer Atem drückt mir auf das Herz, und ich atme erst wieder auf, als mich sein ruhiger Blick trifft.
Es fällt auch mir schwer, mich zu bewegen. Ich spüre meine Knochen, meinen Rücken, der mich kaum noch trägt und den dumpfen Widerstand, der mich seit Jahren davon abhält, mich gänzlich aufzurichten. Ich bin hilflos bin, wie ein Kind. Die vergilbte Schürze liegt auf dem dicken Stoff meines Rockes, wie immer. Ich rieche Schweiß und weiß, dass sich hier lange nichts geändert hat. Je näher ich aber den Flammen komme, desto intensiver trifft mich die Wärme, belebt mich und strömt bis in die Tiefen. Dankbar setzen wir uns auf die Stühle, lächelnd, fast ausgelassen. Ich verberge das eiserne Stechen, das mir beim Hinsetzen in den Rücken fährt, vor ihm, meinem Mann, und ergebe mich dem behaglichen Knistern, das die Erschöpfung eines Lebens entfesselt, das unendlich viel Zeit umfasst und mich tonnenschwer niederdrückt. All das aber spielt keine Rolle angesichts des Glücks, das die Wärme erblühen lässt.
Sie verweilt noch in mir, als das Haus um mich verblasst und mich in einem dunklen Raum zurücklässt, der nur Fremde und Trostlosigkeit verheißt. Die Flammen, das Krachen der Scheite, alles ist verklungen, nicht aber die Beklemmung. Und ich weiß, dass ich den Rest der Szene nicht sehen will.
Ich blicke mich um. Alles sieht falsch aus, wie eine Lüge. Nur der Mann verbindet mich noch mit dem Haus, und weckt eine Sehnsucht, die nicht mir gehört und es doch tut. Ich möchte nicht sehen, was sie mir zeigen will, und will es doch; ich möchte den verblassenden Schatten eines sich zaghaft nähernden Gestern verstehen, in das doch kein Weg zurückführt, in das niemand zurückkehren kann, auch wenn ich es mir einmal so sehr gewünscht habe, dass es mich fast umgebracht hat. Das Ziehen und Stechen in meinem Magen weicht einer Trauer, die mich überfällt, wie eine Bestie. Ich versuche, mich bei dem Mann bemerkbar zu machen, ohne zu verstehen, warum. Ich greife hilfesuchend seine Hand, als hätte ich das schon viele Male getan. Doch sie ist so kalt, dass ich mich schnell zurückziehe und der Trauer hingebe, die auf mich wartet. Vollkommen unfähig, meinem Schicksal entgegen zu sehen, blicke ich zum Fenster in die ausstehende Dämmerung.
„Jaromìr“, flüstere ich mit fremder Stimme, heiser und alt: „Sag etwas.“
Ich rüttele an seinen bewegungslosen Körper und versuche vergeblich, eine Gewissheit auszusperren, die sich ausbreitet, wie vor langer Zeit jene Wärme, die mich nun verhöhnen will. Er ist tot.
Nach Kräften versuche ich, der fremden Trauer standzuhalten. Sie ist roh und urtümlich, wirft mich herum und nimmt mir die Luft. Ich ersticke und versuche gleichzeitig, mich gegen etwas zu wappnen, dem ich nicht gewachsen bin. Dem auch die Frau im Holzhaus nicht gewachsen ist. Dem vielleicht niemand gewachsen ist.
Wieder flackern die Kerzen und baden ihre kleinen Flammen im warmen Feuerschein des Kamins in meinen Gedanken, transparenter diesmal, weniger substantiell. Mit der wenigen Luft in meinen Lungen rufe ich den Namen des Mannes, der mich beschützen kann, doch er bleibt stumm, und kalt. Und ich will es nicht glauben.
Als mich die Trauer mit sich fortreißt, will ich fliehen, dringender als je zuvor. Ich kann nicht erfahren, was ich sehen soll, wohlwissend, dass es mich finden wird. Atemlos lande ich wieder vor dem Kamin. Das Haus ist da, stabil, real und unausweichlich. Mein Mann sitzt neben mir und der Feuerschein spielt mit den Schatten seiner stoppeligen Wangen und den dunklen Augen, die mich ruhig mustern. Die Flammen lodern höher und lauter, als vorhin, sodass man ihre tödliche Kraft spüren kann. Und er genießt sie ebenso, wie ich. Still und tief. Und so surreal, wie der Mann im Apartment es war, wächst eine Ahnung in mir, die alles, was ich bin, und alles, was die Frau im Apartment ist, für immer verändern soll.
Die Holztür bricht auf, dass es kracht und der Schreck fährt mir schneller in die Glieder, als die Gewissheit, die die Männer in Dunkelblau brutal in unser Heim bringen. Ihre Gesichter sind hart und jung und das macht es schlimmer. Wind und Schnee pfeifen in das Haus, wie böse Geister, und gelangen bis vor den Kamin. Die Kerzen verlöschen und die teuflisch lauernde Sprachlosigkeit der letzten Wochen wird gedankenlos vor das Feuer und unsere Füße geworfen. Ich bin wie betäubt.
Wir haben von den Verheerungen und Plünderungen gehört, und geahnt, dass etwas passieren wird. Doch wir haben keinen anderen Ort, an den wir gehen können, als diesen. Mein Kopf hält noch an der einfältigen Hoffnung fest, dass sie gehen, wenn sie sehen, dass wir nichts haben, als Jaromìr aufsteht. Langsam und ohne zurückzuweichen. Er ist groß, mein Mann. Und ohne zu zögern werfen die Männer ihn zu Boden und treten auf ihn ein. Er stöhnt. Sie übersehen mich, doch ich spüre ihre Tritte auch. Der Feuerschein spielt mit seinem Körper und den Umrissen der Männer, wie mit der höllischen Sprachlosigkeit, die in diesem Anblick kumuliert.
Dann stöhnt Jaromìr nicht mehr. Zu zweit heben die Männer ihn an und tragen ihn in unser ärmliches Schlafzimmer, um ihn auf das Bett zu legen. Ich verliere den Halt. Er ist weg. Ich falle. Ich bleibe vor dem Kamin zurück, mein Körper ein einziges Pochen, und doch so still, wie ein Grab. Die Angst wird zu einer Gewissheit, die ich nicht fassen kann. Als die Männer gehen, ohne mich anzusehen, ist es so still, wie noch nie. Das Feuer knistert, die Kerzen sind verloschen und ich schwebe in meiner neuen Ewigkeit. Zeitlos, körperlos und ewig fragend. Jaromìr.
In der Dunkelheit, die vom silbernen Mondlicht hinter dem Vorhang zersetzt wird, weine ich. Ich weiß jetzt, wer der Mann neben mir ist und rufe seinen Namen.
Jaromìr.
Unter dem Schutz dieses Mondes als einzigem Zeugen halte ich seine kalte Hand so fest, wie vor sehr langer Zeit. Sie ist rau und groß und vertraut und Dankbarkeit fängt die Trauer auf, ohne ihre Unerträglichkeit zu lindern. Er ist wieder bei mir, um die Brutalität unserer Trennung zu erklären, die ich noch immer nicht verstehe.
Durch fremde Tränen, die doch meine sind, sehe ich ihn an, sehe seine Gestalt so deutlich, wie damals. Die schmale Stirn, die tiefliegenden Augen, den weißen Bart verfärbt vom Tabak. Jaromìr. Mit dir erkenne ich auch mich.
Ich liege in meinem Apartment, in meinem Bett, und sehe zu, wie die Sonne hinter dem Vorhang aufgeht. Jaromìr ist nur noch eine Erinnerung, wie sehr lange schon. Doch etwas in mir ist leichter. Ich habe nicht geschlafen und weiß nichts mehr, nur, dass etwas wiederkam. Dass jemand wiederkam, dem ich bis in alle Ewigkeit gedenken werde, weil ich es einmal geschworen habe. Einem Mann, den ich liebte. Meinem Mann Jaromìr.