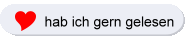Veröffentlicht: 18.08.2025. Rubrik: Nachdenkliches
Das kleine Ding
Es war nicht irgendein kleines Ding.
Es war mein kleines Ding.
Ich kannte es, so lange ich zurückdenken konnte. Klein, empfindlich, ein bisschen verbeult, wie ein zerknittertes Paket, das man zu oft fallen gelassen hat.
Schön war es nicht. Seine Beinchen waren dünn und konnten den kleinen Körper kaum tragen, der vor lauter Rissen, Nähten und Pflastern kaum zu erkennen war. Aber es war meins. Es lebte in mir, trug meine Geschichten, meine Tränen, meine Sehnsucht. Oft war es kaum zu sehen – wie ein Schatten am Rand meiner Existenz – doch heute weiß ich: Es war immer da.
Ich stellte es lange nicht in Frage. Ich ging davon aus, dass jeder eins hatte. Aber meines war anders. Hässlicher. Undefinierbarer. Für viele erschreckend. Für mich war es vertraut.
Trotzdem versuchte ich, es loszuwerden. Es störte, blockierte, machte mich schwach. Es war mir peinlich. Ich wollte nicht, dass jemand dieses unförmige, hässliche Ding sah. Auch wenn es mir im Grunde leidtat, denn es konnte nichts für sein Aussehen. Also schimpfte ich mit ihm, warf ihm alles Mögliche vor und kritisierte es.
Es hörte zu, nickte still, straffte die schmalen Schultern. Es zog sein Schleifchen fester und gab sich alle Mühe, nicht mehr ganz so zerstört zu wirken.
Stolz war es nie auf seine Form. Es wusste um seine Risse, die blasse, manchmal graue Haut. Doch es nahm das hin. So bin ich eben, dachte es. Gottgegeben. Kaputt geboren. Wenn ich mich nur genug bemühe, merkt vielleicht keiner, wie schlimm es ist. Ich muss mich nur etwas mehr bemühen, weniger auffallen und mich zurückhalten.
Und obwohl es so zerbrechlich war, hielt es an einer Sache fest: Hoffnung.
Immer, wenn es gefallen war, ob durch mich oder andere, die es stießen, beschimpften, vergaßen, wartete es. Es wartete darauf, dass ich zurückkam, mich zu ihm setzte, den Dreck abklopfte und sagte: Komm, ich nehme dich wieder mit nach Hause.
Und meistens kam ich auch. Früher oder später. Sehr oft später. Manchmal so spät, dass es schon zitterte vor Kälte. Aber ich kam. Ich hob es auf, und es atmete erleichtert auf. Manchmal blickte es mich mit panischen Fragen in den Augen an, doch ich erklärte mich nie.
Bis zu dem Tag, an dem ich es nicht mehr tat.
Es lag am Rand einer Straße. Der Asphalt heiß, der Graben voller Staub und Steine. Autos rasten vorbei – laut, gleichgültig, gefährlich nah am kleinen Ding. Es klammerte sich an einen Stein, damit sein winziger Körper nicht hinfort geweht wurde.
Es hob den Kopf, wie immer, wenn es Schritte hörte. Seine Augen waren groß, voller Angst, aber auch voller Gewissheit: Sie kommt gleich. Sie kommt immer. Ich muss nur warten.
Es wartete Stunden.
Dann Tage.
Dann Wochen.
Das Licht wechselte – Tag und Nacht, Nacht und Tag. Motoren heulten vorbei, Luftstöße schleuderten Schmutz über seinen kleinen Körper. Es spürte, wie seine Substanz zerbröckelte, wie es mit jeder Nacht ein Stück verlor. Das kleine Ding sah an sich herab und war schockiert: Was von ihm übrig war, war nicht mehr viel. Nichts, wo man noch eine Naht hätte setzen können, auch ein Schleifchen würde ihm nun nicht mehr helfen.
Und irgendwann verstand es: Diesmal nicht. Diesmal holt sie mich nicht zurück.
Die Kälte kroch in es hinein. Nicht die der Nacht, sondern die, die aus Verlassenheit wächst. Eine Kälte, die tiefer reicht als der Körper, die die Seele selbst gefrieren lässt.
Das kleine Ding rollte sich zusammen, weinte leise, hoffte weiter. Denn immer, wirklich immer, war ich zurückgekehrt. Noch nie hatte ich es ganz aufgegeben.
Doch diesmal war es anders.
Zum ersten Mal wusste das kleine Ding: Sie hat mich hier gelassen. Einfach so. Vielleicht für immer.
Es erinnerte sich an all die Stimmen, die gesagt hatten, dass es beschädigt war. Zu schief. Zu schwach. Zu zerkratzt. Es hatte das hingenommen, ohne zu fragen. Ja, stimmt wohl. Ich bin eben so. Kaputt. Unwichtig. Wertlos.
Es hatte sich angestrengt, mehr zu gefallen, sich anzupassen. Aber es hatte nie gereicht. Das kleine Ding hatte sich damit abgefunden, dass es nicht ausreichte, um von der Welt angenommen zu werden. Aber es war da, es atmete noch, und die einzige Person, die auf es geachtet hatte, war doch ich gewesen.
Und nun, im Straßengraben, mit den vorbeirasenden Autos und der Gleichgültigkeit der Welt, verstand es etwas Neues:
Es war nicht einfach kaputt geboren.
Es war kaputt gemacht und dann zurückgelassen worden.
Die schlimmste Wunde war nicht der Dreck, nicht die Schrammen, nicht die Angst vor den Rädern. Die schlimmste Wunde war das Wissen: Diesmal will sie mich nicht retten.
Es hörte mein Lachen, weit weg, in einer anderen Welt. Es spürte, wie ich weiterlebte, ohne es. Und je länger es dort lag, desto stärker wurde die Überzeugung:
Ich bin nicht genug wert, dass man um mich kämpft.
Lange Zeit habe ich nicht hingesehen. Ich wusste, dass es dort lag. Ich spürte es in den stillen Stunden, in den Nächten, wenn der Lärm der Welt abebbte und nur mein eigener Atem übrig blieb. Da war immer dieser leise, bohrende Schmerz, ein Flüstern, das sagte: Du hast es dort gelassen. Du bist nicht zurückgegangen.
Ich habe es verdrängt. Mich gezwungen, zu glauben, dass es vielleicht doch verschwunden ist. Dass das kleine Ding einfach aufgehört hat zu sein, weil ich es nicht mehr ertrug. Aber tief in mir wusste ich: Es lag noch dort. Und es wartete.
Als ich schließlich zurückkam, war nichts so wie früher.
Kein erwartungsvolles Heben des Kopfes. Kein Zittern, kein ängstliches Schauen, ob ich diesmal wieder die Schritte war, die es retten würden.
Es lag einfach nur da.
Stumm.
Als hätte es längst aufgegeben.
Und das war das Schlimmste.
Nicht die neuen Risse, nicht der Schmutz, nicht das Zittern der kalten Nächte. Sondern diese Stille. Diese Gleichgültigkeit, die in seinen Augen lag, die komplette Resignation.
Es hatte aufgehört, an mich zu glauben.
Ich kniete mich hin, fühlte, wie mir die Kehle zuschnürte.
„Es tut mir leid“, brachte ich heraus, aber meine Worte klangen dünn, erbärmlich gegen das Brüllen der Autos.
Es rührte sich nicht. Keine Reaktion, kein Zeichen, dass es überhaupt noch verstand, dass ich da war.
Und da wurde mir klar: Ich hatte es gebrochen. Nicht die Welt. Nicht die anderen. Ich.
Am Ende waren es meine Entscheidungen gewesen, die es komplett zerstört hatten.
Ich wollte weglaufen, so wie früher. Ich wollte die Augen schließen, mir einreden, dass es zu spät sei, dass es einfacher wäre, es liegenzulassen. Aber etwas in mir zwang mich, die Hand auszustrecken. Ich berührte die kalte, verschmutzte Haut. Sie war so dünn geworden, so fremd. Und dennoch sofort vertraut.
„Ich weiß, du glaubst mir nicht mehr. Und du hast recht. Ich habe dich verraten.“
Meine Stimme war rau, voller Schluchzen, das ich nicht mehr zurückhalten konnte.
„Aber diesmal gehe ich nicht. Auch wenn du mich hasst, auch wenn du mich nicht mehr ansiehst. Ich lasse dich hier nicht verrotten.“
Langsam hob ich es hoch.
Es war erschreckend leicht, kaum schwerer als ein Bündel Blätter. So leicht, dass ich Angst hatte, es könnte mir im nächsten Windstoß wieder entgleiten. So wenig war von ihm übrig, dass andere es sicher übersehen hätten.
Ich hielt es fest, fester als jemals zuvor.
Es zitterte nicht, es weinte nicht. Es ließ es einfach geschehen, regungslos, wie ein Wesen, das keine Kraft mehr für Widerstand hat. Das kleine Ding war gebrochen, das spürte ich sofort. Es hatte seinen Mut und seinen Geist verloren, und auch jeden Funken Hoffnung.
Und ich spürte, dass das fast schlimmer war als jede Abwehr. Früher hatte das kleine Ding manchmal gezetert und sich gewehrt. Es hatte sich aufgebäumt gegen Ungerechtigkeiten und wollte nicht zurück an Orte, an denen es ihm nicht gut ergangen war. Aber jetzt schien es ihm egal, wohin ich es brachte.
Ich trug es heim. Jeder Schritt fühlte sich wie ein Schuldbekenntnis an, schwer, unendlich schwer. Ich hatte ihm das angetan, obwohl ich es hätte besser wissen müssen.
Und als ich es endlich in meine Wohnung auf den Tisch vor mir setzte, mitten in mein Leben, war da nichts von Erleichterung. Keine Wärme, keine Versöhnung. Es freute sich nicht, wieder bei mir zu sein. Es wollte keine Verbindung mit mir und sah mich nicht an.
Nur diese bedrückende Stille.
Aber ich blieb.
Ich sah es an, und ich schwor mir: Nie wieder lasse ich es zurück. Auch wenn es mir nie verzeiht. Auch wenn ich es nicht wieder gutmachen kann. Ich bleibe.
Und vielleicht, eines Tages, würde dieses kleine Ding wieder atmen. Aber in diesem Moment war da nur die Kälte, die ich selbst geschaffen hatte – und das Wissen, dass ich sie aushalten musste, wenn ich es wirklich retten wollte.
Das kleine Ding war zurückgekehrt, weil ich es zurückgeholt hatte.
Aber es war nicht dasselbe wie früher.
Früher hatte es mir geglaubt, wenn ich ihm versprach: „Es ist alles gut. Ich schütze dich. Ich passe auf dich auf.“ Obwohl ich es viele Male vorher enttäuscht hatte.
Es hatte sich in meinen Händen zusammengerollt, gebrochen, ängstlich, aber voller kindlicher Gewissheit, dass ich stärker war als die Welt da draußen. Und das ich es vor allem nicht absichtlich Gefahr ausliefern würde.
Aber jetzt nicht mehr.
Jetzt sah es mich an wie einen, der längst überführt ist.
Wie jemanden, der große Worte macht und doch am Ende dieselben Messer zückt wie alle anderen.
Und es hatte Recht.
Denn wie oft hatte ich es selbst zum Schweigen gebracht, weil es mich störte? Wie oft hatte ich ihm befohlen, still zu sein, hart zu sein, alles zu ertragen, damit ich meinen Platz im Außen nicht verlor?
Ich hörte meine eigene Stimme in seinem Inneren:
„Stell dich nicht so an. Anderen geht es auch nicht besser. Halte still, sei dankbar, dass du überhaupt etwas hast. Wenn du dich wehrst, verlierst du alles.“
Das kleine Ding hatte gehorcht. Immer und immer wieder.
Es hatte sich die Schreie in die Kehle zurückgedrückt, die Tränen verschluckt, die Zähne zusammengebissen.
Es hatte versucht, brav zu sein.
Und während es sich bemühte, nicht im Weg zu sein, kamen die anderen.
Die Stimmen draußen, die Hände, die Blicke. Sie hatten es gestoßen, getreten, verspottet. Sie hatten ihm vorgemacht, dass es existieren darf, wenn es Regeln befolgt. Nur um diese dann wahllos und nach dem eigenen Gusto zu ändern. Oder sie versprachen Loyalität, die am Ende nur eine Einbahnstraße war.
Nicht, weil es ihnen etwas getan hätte, sondern weil es da war. Weil es schwach war. Weil man es konnte.
Und ich stand daneben.
Manchmal versuchte ich, das verhalten der anderen zu rechtfertigen. Manchmal tat ich so, als hörte ich es nicht, wenn das kleine Ding leise weinte. Manchmal sah ich weg, weil ich dachte, dass ich selbst sonst nicht überlebe. Für mich war das kleine Ding in Problem, denn es forderte zu viel.
Viel zu viel von dem, was andere nicht bereit waren zu geben. Viel zu viel von dem, was ich ihm nicht geben konnte.
Das kleine Ding hatte nie verstanden, warum ich es nicht verteidigt hatte.
Warum ich nicht schrie, wenn es geschlagen wurde. Warum ich nicht dazwischen ging, wenn jemand seine Risse noch tiefer drückte.
Warum ich es oft sogar selbst noch schärfer maßregelte als die anderen, damit es ja keinen Ärger machte.
Und nun, jetzt, nachdem ich es so lange im Straßengraben zurückgelassen hatte, war dieser Zweifel zur Gewissheit geworden:
Nicht nur die Welt da draußen war gefährlich. Auch ich war es.
Es hockte in seiner Ecke, direkt zwischen Wand und einem Stapel Zeitungen, und seine Augen waren nicht mehr die eines kleinen, verletzlichen Wesens, das um Hilfe bittet.
Sie waren stumpf geworden, abgebrüht. Jeder Funken Lebendigkeit war daraus erloschen.
Es glaubte niemandem mehr.
Nicht den Fremden, die es verspottet hatten.
Nicht den Menschen, die sagten, sie liebten mich, aber es im selben Atemzug verachteten.
Und nicht mir – der, die immer versprach und nie schützte.
Es war mir nie so bewusst gewesen wie jetzt, wie ramponiert es tatsächlich aussah.
Sein Körper war ein einziges Flickwerk.
Überall Risse, die notdürftig gekittet waren, Wunden, die nie verheilt, nur vernarbt waren.
Manche Narben waren alt und dick, wie Schichten, die immer wieder aufgerissen worden waren.
Andere waren frisch, rot, blutig. Die Größte davon trug es über dem Herzen, und unter der dünnen Oberfläche sah ich einen blassrosa Herzschlag.
Ich fragte mich, wie es das all die Jahre überstanden hatte.
Wie es überhaupt noch existierte, wo doch so vieles in ihm zerbrochen war.
Aber vielleicht war das der Punkt: Es existierte nur noch.
Es lebte nicht.
Es atmete, es war da, aber mehr auch nicht.
Manchmal hörte ich es leise murmeln, wenn es dachte, ich sei nicht da. Worte, die mich durchschnitten wie Glas:
„Warum ich? Warum bin ich so gemacht? Warum hat sie mich nicht verteidigt?“
Ich wollte schreien, dass es nicht seine Schuld war. Dass es nie schwach geboren wurde, sondern schwach gemacht. Dass ich es nicht besser konnte und auch nicht wusste, weil mir doch am Ende nichts anders übrig blieb, als in dieser Welt irgendwie zu existieren. Aber das half nichts.
Denn die Wahrheit war: Ich hatte es nicht verteidigt.
Ich hatte es geopfert, immer wieder, für das Außen.
Für ein bisschen Ruhe. Für ein bisschen Anerkennung. Für die Illusion, dazugehören zu dürfen. Und vor allem für die Sicherheit eines anderen Menschen, der sich seiner Verantwortung entzogen hatte.
Ich sprach jeden Tag mit dem kleinen Ding, aber es antwortete lange nicht. Ich trug es herum, ich kümmerte mich darum, aber es sah mich kaum an. Ich malte es an, erneuerte sein Schleifchen, ich redete weiter. Doch das kleine Ding sah mich nur weiter mit großen, entgeisterten Augen an, und blieb in seiner Welt.
Jede Nacht rolle es sich neben mir zu einer winzigen Kugel zusammen und weinte. Leise, damit niemand es hörte. Aber ich hörte es. Aber ich tat nichts, denn das hätte bedeutet, dass ich mich noch sehr viel deutlich meiner eigenen Schuld hätte stellen müssen.
Also blieb ich still.
Es dauerte Monate, bis es zu sprechen begann.
Erst einzelne Worte, die so leise waren, dass ich sie manchmal nicht verstand. Ich horchte aufmerksam, aber am Ende musste ich immer feststellen, dass ich ihm nicht helfen konnte. Es bat um einen neuen Körper, um eine andere Gestalt, darum, dass irgendjemand es sah. Aber diesen Wunsch konnte ich ihm nicht erfüllen. Also hörte ich nur zu, wie das kleine Ding klagte.
Als es lauter und deutlich wurde, versuchte ich es zu beruhigen, wusste aber nicht wie.
Das kleine Ding glaubte mir nicht, wenn ich sagte: „Diesmal passe ich auf dich auf.“
Es antwortete: „Hast du nie. Wirst du nie.“
Es glaubte mir nicht, wenn ich versprach: „Niemand wird dir mehr weh tun.“
Es lachte bitter: „Du kannst es nicht verhindern. Du hast es nie verhindert. Du hast mich ausgeliefert.“
Und schlimmer noch: Ich glaubte es selbst nicht.
Denn tief in mir wusste ich, dass ich nicht stark genug war. Dass ich immer wieder einknicken würde, wenn die Welt laut genug schrie. Dass ich es übergehen würden, um den dünnen Faden zur Außenwelt nicht zu verlieren. Dass ich es wieder zum Schweigen bringen würde, damit ich meine Rolle weiterspielen konnte.
Und so saßen wir nebeneinander, wie zwei Fremde, die denselben Körper teilen, aber nicht dieselbe Sprache sprechen.
Das kleine Ding zog sich zurück. Nicht trotzig, sondern endgültig.
Es wollte nicht mehr kämpfen, nicht mehr hoffen, nicht mehr warten. Es wünschte sich einen sicheren Ort, den ich ihm nicht bieten konnte.
Und ich wusste: Wenn es verstummte, wenn es aufhörte, auch nur noch still da zu sein, dann war auch ich verloren.
Aber ich konnte es nicht zwingen.
Alles, was mir blieb, war die Schuld.
Wenn ich es fragte, warum es mir misstraute, hatte es allen Grund dazu. Ich hatte alles getan, um das Vertrauen des kleinen Dinges zu zerstören.
Weißt du, was das Schlimmste war?
Nicht die Jahre davor. Nicht die Schläge der anderen, nicht das Gelächter in den Fluren, nicht die Nächte, in denen niemand kam. Das war schlimm, ja. Aber ich kannte das. Ich hatte gelernt, dass die Welt grausam ist. Dass andere mich hässlich finden, wertlos, lästig. Ich hatte gelernt, dass ich stillhalten muss, damit es nicht noch schlimmer wird.
Aber damals, beim letzten Mal – da war es anders.
Da warst du es.
Du hast mir gesagt: Vertrau mir. Es ist richtig so.
Du sagtest mir, ich solle vertrauen. Ich wollte nicht. Mein ganzer kleiner Körper zitterte, ich spürte den Geruch von Gefahr in der Luft. Alles in mir schrie, dass es nicht gut war. Aber hast darauf bestanden. Du hast gesagt, ich soll vertrauen und mich auf dich verlassen. Du hast gesagt, es wäre diesmal anders. Du hast gesagt, dass er mich gesehen hat, und mir genau deshalb nicht weh tun würde.
Ich habe mich gesträubt. Ich habe geschrien, so laut ich konnte, in deinem Inneren. Ich habe gezittert und gefleht: Bitte nicht. Bitte, wir wissen doch, was passiert. Er wird uns fallenlassen. Er wird uns verletzen. Er wird uns nicht halten.
Ich habe dir Bilder geschickt, Erinnerungen, all die Narben, die ich trage. Ich habe dich gewarnt. Ich habe alles getan, damit du diesen Fehler nicht machst.
Aber du hast mich gezwungen. Du hast gesagt, man muss mutig sein, um Veränderung zu erzielen.
Du hast mich gepackt, mir die Hände auf den Rücken gebunden und gesagt: Jetzt sei still. Diesmal ist es anders. Er ist nicht so.
Und ich habe dir geglaubt. Weil ich keine Wahl hatte.
Ich habe mein Gesicht in deinen Händen vergraben, so voller Angst, und du hast mich hineingeschoben in dieses Vertrauen, das sich wie ein Abgrund anfühlte.
Und dann kam er.
Und tat – nichts.
Er sah mich nicht. Er hörte mich nicht. Er ließ uns allein, in einer Situation, die größer war als alles, was wir tragen konnten. Er sprach über mich, als wäre ich eine Sache der anderen Menschen, aber mich ignorierte er. Er tat, als sei mein Verlust nicht seine Sache.
Und während ich endgültig zerbrach, während ich voller Panik wartete, dass er eine Hand ausstreckt, dass er sagt: ‚Ich sehe dich, ich bleibe da‘ – war da nur Leere.
Nur Schweigen.
Nur die Gewissheit, dass ich völlig egal bin. Nicht nur ihm, sondern auch dir, weil dir seine Sicherheit viel wichtiger war, als deine eigene.
„Wie konntest du?“, wollte ich schreien, aber kein Laut kam heraus. Ich war starr, wie eingefroren. Denn tief drinnen wusste ich: Wenn ich jetzt schreie, wenn ich mich auflehne, dann wirft sie mich weg. Diesmal endgültig.
Und du?
Du hast mich nicht festgehalten.
Du hast mich nicht getröstet.
Du hast mich nicht in die Arme genommen und gesagt: ‚Es tut mir leid, ich habe dich verraten.‘
Du hast mich weggeworfen. Und ich lag da, klein, schmutzig, unförmig, ohne Schleifchen diesmal.
Du hast gesagt: Stell dich nicht so an. Halt still. Aushalten. Anders geht es nicht.
Und dann lag ich da.
Zerfetzt.
Allein.
Mit einem Schmerz, der tiefer schnitt als alles zuvor.
Verstehst du, warum ich nicht mehr glauben kann?
Verstehst du, warum jede deiner Stimmen nach Trost für mich klingt wie Hohn?
Es war nicht irgendein Verrat.
Es war der Letzte.
Der, der mich hat begreifen lassen: Es gibt keinen Ort, an dem ich sicher bin. Nicht draußen, nicht bei ihm, nicht einmal bei dir. Und seitdem bin ich nicht mehr das, was ich war.
Ich bin fransig, dunkel, durchzogen von einer Fäulnis, die aus der Seele kommt. Ich glaube niemandem mehr. Nicht den anderen, nicht dir.
Ich baue dem kleinen Ding ein Nest.
Weich, dunkel, geschützt. Einen Ort, an dem niemand es sehen, niemand es erreichen kann. Dort bette ich seinen geschundenen Körper, wasche jeden Tag den Schmutz von seiner Haut, nähe behutsam seine Wunden. Ich verspreche ihm, dass niemand hereinkommen wird. Nicht er. Nicht die anderen. Nur ich.
Doch das kleine Ding glaubt mir nicht. Es liegt still, wie ein Tier, das längst weiß, dass jedes Versprechen eine Lüge sein kann. Seine Augen sind groß und leer, und wenn es mich ansieht, dann nicht mit Hoffnung, sondern mit der Gewissheit, dass auch ich es wieder verraten werde.
Ich sage ihm, dass es nichts tun muss. Dass es nicht mehr kämpfen, nicht mehr reagieren, nicht mehr gefallen muss. Dass es still liegen darf, ohne Angst, ohne Erwartungen. Doch in seinem Schweigen liegt ein bitteres Lachen. Ich höre es, auch wenn es keinen Laut von sich gibt: Du hast mir das schon einmal gesagt. Du hast gesagt, ich solle vertrauen. Und dann hast du mich gezwungen. Du hast mich in fremde Hände gelegt, obwohl ich mich gewehrt habe. Und als die Hände mich zerbrochen haben, hast du mich weggeworfen. Wer sollte dir jetzt glauben?
Ich habe keine Antwort darauf. Nur die Stille zwischen uns. Nur mein Versprechen, dass ich diesmal alles ertragen werde. Ich werde die Schläge nehmen, die Tritte, die Enttäuschungen. Ich werde mich beugen, schweigen, unter allen Radaren laufen – damit das kleine Ding nicht mehr getroffen wird. Ich lasse zu, dass die Welt mich bricht, solange es das kleine Ding nicht mehr ertragen muss.
Aber es glaubt mir nicht.
Es weiß, dass ich es nie beschützt habe. Dass ich immer nur gesagt habe: Stell dich nicht so an. Halt durch. Trag es wie alle anderen. Und als es eines Tages wirklich nicht mehr konnte, habe ich es in den Graben geworfen. Es erinnert sich. Es vergisst nicht.
Ich sehe die Narben, die nicht mehr heilen wollen. Ich spüre die Kälte, die aus ihm herausdringt. Sie sitzt tief in seiner Substanz, so tief, dass es nicht mehr weiß, ob es überhaupt noch etwas anderes gibt.
Ich sage ihm, dass ich bleibe. Jeden Tag werde ich kommen, werde mich zu ihm setzen, werde es halten, auch wenn es mich wegstößt. Ich werde seinen Blick aushalten, wenn er mich anklagt, ohne mich zu rechtfertigen. Ich werde nicht sagen, dass ich es nicht besser wusste. Ich werde nur sagen: Ja. Ich hätte dich schützen müssen. Ich habe es nicht getan.
Und wenn es schreien will, lasse ich es schreien. Wenn es toben will, lasse ich es toben. Ich werde nichts erwidern, nichts verteidigen. Ich nehme alles auf mich. Denn ich weiß, dass es keinen weiteren Riss mehr erträgt.
Das kleine Ding antwortet nicht. Es rollt sich zusammen, die Haut grau, der Atem flach. Es sieht mich an, als sei ich nur noch ein Schatten, der irgendwann verschwinden wird. Und vielleicht hat es recht. Vielleicht wird es mir nie mehr glauben. Und wenn es das tut, dann habe ich das verdient.
Aber ich bleibe.
Auch wenn es mich hasst, auch wenn es mir nie verzeiht. Ich bleibe. Damit es wenigstens ein einziges Mal nicht zurückgelassen wird.
Das kleine Ding liegt noch immer still. Es glaubt mir nicht, nicht nach allem, was war. Aber ich bleibe. Jeden Tag gehe ich zu ihm, in diesen Raum, den ich für es geschaffen habe. Ich setze mich daneben, auch wenn es mich nicht ansieht, auch wenn sein kleiner Körper starr bleibt, als sei er schon versteinert. Ich spreche nicht viel, weil es keine Worte mehr hören will. Ich bin einfach da. Ich halte die Kälte von ihm fern, so gut ich kann, und ich atme gleichmäßig, damit es meinen Rhythmus spürt.
Draußen, im Lärm der Welt, tue ich, was man von mir verlangt. Ich nicke, ich arbeite, ich schlucke den Schmutz, den man mir hinwirft. Ich lasse ihn nicht mehr hinein, nicht bis zu dem kleinen Ding. Es darf schlafen, während ich draußen kämpfe. Es darf liegen bleiben, ohne erklären zu müssen, warum es so zerbrochen ist. Ich trage die Masken, ich nehme die Schläge, ich erdulde die Enttäuschungen – alles, damit es nichts mehr davon spüren muss.
Das kleine Ding bleibt abgewandt, die Augen geschlossen, als wollte es nicht einmal bemerken, dass ich noch da bin. Aber irgendwann zuckt es, kaum sichtbar. Ein Zittern, ein winziges Aufbäumen, bevor es gleich wieder in sich zusammensinkt. Ich tue nichts, um es zu erzwingen. Ich warte. Ich lege nur meine Hand neben seinen kleinen Körper, nicht darauf, und lasse sie dort liegen, bis es vielleicht einmal selbst den Mut findet, sich daran zu lehnen.
So vergehen Tage. Vielleicht Wochen. Ich zähle sie nicht, weil Zeit hier keine Rolle spielt. Alles, was zählt, ist das Versprechen, das ich ihm gegeben habe: dass ich nicht mehr gehe. Dass es nicht wieder alleine am Straßenrand liegenbleibt, während ich verschwinde.
Das kleine Ding weiß noch immer nicht, ob es mir glauben darf. Aber es beginnt, mein Schweigen zu hören. Mein Aushalten. Mein Bleiben.
Und in einer Nacht, als ich wieder neben ihm sitze, höre ich es leise atmen. Nicht mehr stoßweise, nicht mehr stockend. Sondern gleichmäßig, fast ruhig. Es schläft, zum ersten Mal ohne Angst, dass ich es im Schlaf zurücklassen könnte.
Und ich weiß: Das ist der Anfang. Kein Verzeihen, noch lange kein Vertrauen. Aber der Anfang eines langsamen, zerbrechlichen Heilens.
 1x
1x