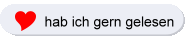Veröffentlicht: 01.02.2026. Rubrik: Historisches
Hochzeitsreise nach Köln
Der Sommerwind peitschte durch die Straßen Kölns und trug den Geruch von Kohlerauch, Kartoffelschalen und fernen Schlachtfeldern mit sich. Nach drei Jahren Krieg zeigten sich die Spuren des Mangels überall: leere Schaufenster, deren Glasscheiben mit Pappe und Zeitungspapier geflickt waren, dünne Gesichter mit eingefallenen Wangen, Frauen in Kleidern aus Ersatzstoffen, die mehr geflickt als neu waren. Selbst die Kinder auf den Straßen trugen Schuhe aus Holz und Pappe, ihre Beine dünn wie Stöckchen. In den Bäckereien hingen Schilder: „Brot nur gegen Marken“, und die Marken waren meist schon am Montagmorgen aufgebraucht.
Das Tivoli-Theater am Deutzer Hafen leuchtete wie ein goldener Leuchtturm in der Dunkelheit einer ausgehungerten Stadt. Seine Fassade, einst stolz und prunkvoll, zeigte mittlerweile die Narben der Zeit – abgeblätterte Farbe, notdürftig reparierte Fenster, und auch die Plakate an den Wänden waren aus Mangel an Papier mehrfach überklebt. Doch die Kronleuchter im Inneren strahlten noch immer mit der Kraft vergangener Glanzzeiten, auch wenn einige Glühbirnen durch die Stromrationierung erloschen waren. Ein Theaterbesuch war mittlerweile purer Luxus, den sich nur wenige leisten konnten – eine Eintrittskarte kostete so viel wie ein ganzes Pfund Fleisch, wenn man denn welches bekommen konnte.
An diesem Abend drängten sich Fronturlauber mit hohlen Wangen und nervös zuckenden Händen neben Krankenschwestern mit müden Augen und Flecken von Karbolsäure an den Ärmeln. Offiziere in gestärkten Uniformen, deren Stiefel noch glänzten, saßen Schulter an Schulter mit Zivilisten, deren Kleider bereits die Sparsamkeit der Kriegszeit verrieten – gewendete Mäntel, gestopfte Strümpfe, Hüte, die schon bessere Tage gesehen hatten. Alle suchten sie dasselbe: einen Moment des Vergessens, einen Hauch von Leben inmitten des Sterbens.
In der zweiten Reihe saß Reservist Willy Pongs aus Gladbach, seine zweiunddreißig Jahre zeigten sich bereits in den Furchen um seine Augen, seine Hände noch rau von den Schützengräben bei Ypern – und von der harten Arbeit als Schneider und Fabrikarbeiter, bevor ihn der Krieg an die Front gerufen hatte. Die Uniform, frisch gebürstet für diesen besonderen Anlass, konnte nicht verbergen, was er gesehen hatte. Sein militärischer Schnurrbart war sorgfältig gestutzt, und sein direkter, ehrlicher Blick ruhte auf der Bühne mit der Konzentration eines Mannes, der gewohnt war, Befehle zu befolgen und seine Pflicht zu tun – auch wenn diese Pflicht heute darin bestand, seiner Frau einen schönen Abend zu bereiten.
Neben ihm Martha, seine frischgebackene Ehefrau – mit siebenunddreißig Jahren längst eine „alte Jungfer“ nach den Maßstäben der Zeit, doch eine Frau von bemerkenswerter Schönheit mit dunklen, ausdrucksstarken Augen und einem Gesicht von klassischer Eleganz. Ihr blaues Kleid mit dem weißen Kragen, mehrfach gewendet und geändert in den mageren Jahren, konnte ihre natürliche Anmut nicht verbergen und war ihr bestes Stück, aufgehoben für diesen einen, kostbaren Abend. Ihre Haltung war aufrecht und selbstbewusst, und in ihren Augen lag eine stille Stärke – sie war eine Frau, die wusste, was sie wollte, und die sich bewusst für diesen ehrlichen, einfachen Mann entschieden hatte, trotz aller Widerstände ihrer Familie.
Die Schwiegermutter saß kerzengerade da, den Hut wie eine Krone aufgesetzt, die Lippen noch immer schmal vor der Erinnerung an jenen demütigenden Gang zu den Eltern. Ihre eigenen Handschuhe zeigten bereits kleine Risse – auch sie war nicht verschont geblieben von den Entbehrungen. Dass ihre bildschönen Töchter – Martha und Linna – überhaupt hatten um Erlaubnis bitten müssen, zu heiraten! Zwei Frauen, um die sich in besseren Zeiten die Männer gerissen hätten. Bei Martha besonders hatten sie gezögert, gestritten, den Kopf geschüttelt. „Dä Pongs, Willy? En Schneijer, en einfache Fabriksmann ohne Jeld?“ Und bei Linna erst recht: „Der Hermgens, Hermann? Ein Taugenichts ohne Moral!“ Obwohl Hermann paradoxerweise nie um Geld verlegen war – ganz im Gegensatz zu den meisten anderen in diesen harten Zeiten. Woher das Geld kam, fragte lieber niemand zu genau nach. Aber der Krieg hatte alte Regeln gebrochen, und schließlich war die Erlaubnis gekommen – widerwillig, aber sie war gekommen. Dass ihr Schwiegersohn sie mit auf die Hochzeitsreise genommen hatte, war in ihren Augen sowohl rücksichtsvoll als auch völlig unromantisch.
Doch es war Hermann Hermgens, der die wahre Spannung in ihre kleine Gruppe brachte. Der Ehemann von Marthas Schwester Linna saß mit der lässigen Eleganz eines Mannes, der es gewohnt war, Situationen zu seinem Vorteil zu wenden – und der trotz aller Entbehrungen, die der Krieg über Deutschland gebracht hatte, niemals um Geld verlegen war. Seine Augen hatten etwas Verschmitztes, fast Listiges – der Blick eines Mannes, der immer drei Schritte vorausdachte und jede Gelegenheit erkannte, bevor andere sie überhaupt wahrnahmen. Seine Finger – geschickt im öffnen fremder Schlösser und Herzen – trommelten nervös auf seinen Knien, während er gleichzeitig zärtlich Linnas Hand hielt. Auch er hatte um Linnas Hand bitten müssen, und die Eltern hatten lange gezögert, ehe sie einem Mann ohne festen Beruf ihre Zustimmung gaben – einem Mann, dessen Ruf als Taugenichts und Schürzenjäger bereits die Runde gemacht hatte, der aber andererseits offenbar über Mittel verfügte, die sich andere in diesen mageren Jahren nicht leisten konnten.
Seine Affären waren der Schwiegermutter ein Dorn im Auge, und mehr als einmal hatte sie Linna gewarnt: „Dä Hermann deih der et Herz breche, jenu so wie all dä annere!“ Aber Linna liebte ihn trotz allem – oder vielleicht gerade deswegen. Mit ihrem sanften Gesicht, den hellen Augen und dem warmen Lächeln war sie eine Frau, die Männerherzen höher schlagen ließ, doch sie hatte ihr Herz nur diesem einen Taugenichts geschenkt. Ihre träumerische Art und ihr vertrauensvoller Blick zeigten eine Frau, die an das Gute in den Menschen glaubte – auch wenn diese Gutgläubigkeit sie blind machte für Hermanns wahre Natur.
Das Theater war für Hermann kein Ort der Entspannung, sondern ein Jagdrevier – sowohl für leichte Beute als auch für neue Eroberungen. Schon beim Betreten hatte er die Ausgänge gemustert, die Taschen der anderen Besucher taxiert, die Sicherheitsvorkehrungen abgeschätzt. Aber seine Augen suchten auch nach etwas anderem: nach den Damen, die allein gekommen waren, nach den gelangweilten Ehefrauen, nach den jungen Frauen, die seinen charmanten Blick erwidern könnten. Dabei drückte er Linnas Hand sanft, flüsterte ihr liebevolle Worte ins Ohr – ein Mann, der seine dunkle und seine helle Seite mit derselben Perfektion beherrschte.
„Beruhig dich, Hermann,“ hauchte Linna ihm zu, doch seine Augen wanderten bereits zu einer Dame in der ersten Reihe, deren Handtasche verdächtig prall aussah – und deren Ausschnitt nicht minder interessant war. Eine rothaarige Schauspielerin in der dritten Reihe hatte ihm bereits einen vielversprechenden Blick zugeworfen.
Willy hatte nur zwei kostbare Tage Fronturlaub erhalten – gerade genug für eine Kriegstrauung mit Martha und die einstündige Zugfahrt von Gladbach nach Köln zu machen. Dabei dachte Willy noch immer an die karge Zeremonie gestern: Eine Kriegstrauung, das war ein Verfahren, das der endlose Krieg hervorgebracht hatte. Wenn Soldaten nur wenige Tage, manchmal nur Stunden Urlaub erhielten, konnte auf all die bürokratischen Hürden verzichtet werden, die eine Hochzeit in Friedenszeiten erschwerten. Kein Aufgebot, das wochenlang aushängen musste, keine aufwendigen Vorbereitungen, keine langen Wartezeiten beim Standesamt. Der Standesbeamte kam auch an einem Sonntag, auch zu ungewöhnlichen Zeiten, und vollzog die Trauung mit wenigen Worten und Handgriffen. In einer Zeit, in der das Leben täglich bedroht war, hatte die Bürokratie dem Herzschlag weichen müssen. „Kriegsgetraut“ – so nannten es die Menschen, und jeder verstand sofort: Hier hatte die Liebe über die Umstände gesiegt, hier hatte sich ein Paar das Glück genommen, das es greifen konnte, ehe der Krieg es wieder auseinanderriss.
So war es auch bei Willy und Martha gewesen. Gestern früh noch die hastige Zeremonie auf dem Standesamt in Waldhausen, die Ringe getauscht in der Anwesenheit zweier fremder Zeugen, dann der Zug nach Köln – und nun dieser Theaterabend als ihre einzige Hochzeitsreise. Keine große Reise, kein Festbankett – doch für einen einfachen Soldaten, der vor dem Krieg als Schneider und Fabrikarbeiter gelebt hatte, war ein Theaterabend schon eine teure Angelegenheit. Besonders in Zeiten, in denen eine Scheibe Brot mehr wert war als einst ein ganzes Menü.
Monatelang hatte Martha jeden Krümel Brot zur Seite gelegt, hatte ihre eigenen Rationen gekürzt und heimlich in einer alten Keksdose gespart. Jede Brotkruste, jeden Kartoffelschale, jeden Tropfen Milch, den sie entbehren konnte. Jeden Abend, wenn die Mutter bereits schlief, hatte sie das harte Brot in dünne Scheiben geschnitten und zum Trocknen ausgelegt, damit es für die Reise nach Köln haltbar blieb. Ihre Hände waren rauh geworden vom ständigen Flicken und Wenden der Kleider, vom Sammeln von Brennholz und Kohlestückchen. Ein Stück Speck, für den sie ihre letzte silberne Brosche eingetauscht hatte – ein Erbstück ihrer Großmutter –, lag sorgsam in Pergamentpapier gewickelt in ihrer Reisetasche. Dazu eine kleine Flasche Milch, die sie gegen eine Handvoll Knöpfe getauscht hatte. Sie wollte ihn wenigstens einmal das Gefühl geben, als gäbe es keinen Krieg, keine Lebensmittelkarten, keine leeren Regale, als stünden nicht schon morgen die Züge bereit, die ihn zurück an die Front bringen würden.
Das Programm begann mit einer Sopranistin, deren "Heimat, o Heimat" mehr Sehnsucht als Freude in den Saal trug. Ihre Stimme zitterte leicht – auch sie hatte wohl Söhne oder einen Ehemann an der Front. Jongleure ließen ihre Keulen durch die Luft wirbeln, während das Publikum versuchte, in ihren Bewegungen die Leichtigkeit zu finden, die ihnen das Leben genommen hatte. Doch die Keulen waren aus Holz statt aus dem üblichen Elfenbein – auch hier hatte der Krieg seine Spuren hinterlassen. Ein tanzendes Zwillingspaar aus Prag brachte tatsächlich einige zum Johlen – für einen Moment vergaßen sie, dass ihre Söhne, Brüder, Väter in fremder Erde lagen.
Dann senkte sich das Licht, und eine neue Atmosphäre erfüllte den Saal.
Weißer Nebel quoll über die Bühne, gespenstisch und geheimnisvoll. Aus seinem Herzen trat eine Gestalt hervor, die selbst in diesen dunklen Zeiten noch an Wunder glaubte: Professor Abrakadino. Der schwarze Frack saß perfekt, der Zylinder glänzte, als hätte er nie den Staub der Zeit gespürt. Sein silberner Stab fing das Licht ein und warf es in funkelnden Reflexen in den Saal.
„Meine Herrschaften!“ rief er mit schmelzendem Wiener Akzent, „in ana Welt, wo lauter Schrecken herumschwirrn, brauch ma mehr denn je... des Uummgliche!“
Hermann lehnte sich vor. Zauberer waren für ihn besonders interessant – wer das Auge täuschen konnte, verstand etwas von seinem Handwerk. Er beobachtete jede Bewegung, suchte nach den Tricks, den verborgenen Mechanismen, während seine freie Hand bereits die vertrauten Bewegungen des Taschendiebstahls probte. Gleichzeitig drückte er Linnas Hand und flüsterte ihr zu: „Sieh nur, Liebling, wie elegant er sich bewegt.“ Seine Stimme war voller Zärtlichkeit, auch wenn seine Augen systematisch durch den Saal wanderten. Die Handtasche der eleganten Dame in der ersten Reihe ruhte unbeaufsichtigt neben ihrem Stuhl – und die Dame selbst schien durchaus empfänglich für männliche Aufmerksamkeit zu sein, wie ihr Lächeln in seine Richtung verriet. Ein älterer Herr drei Reihen vor ihm hatte seine Brieftasche unvorsichtig in die äußere Jackentasche gesteckt. Die rothaarige Schauspielerin warf ihm immer wieder Blicke zu. Hermann katalogisierte jede Gelegenheit – geschäftlicher wie privater Natur – während er gleichzeitig liebevoll Linnas Haar streichelte.
„Doch kein Wunder gelingt ohne einen ehrenwerten Helfer aus dem Volke!“ Der Zauberer ließ seinen Blick schweifen – über die Offiziere, die Damen, die Zivilisten. Sein Zeigefinger bewegte sich langsam durch die Reihen, als würde eine unsichtbare Kraft ihn leiten. „Sie dort, Herr Soldat mit dem ehrlichen Gesicht! Kommen Sie zu uns auf die Bühne.“
Der Finger zeigte direkt auf Willy.
Die Welt schien für einen Moment stillzustehen. Willy fühlte, wie sich sein Magen zusammenkrampfte, wie das Blut aus seinem Gesicht wich. Hunderte von Augen wandten sich ihm zu, Hunderte von Gesichtern starrten ihn an. Seine Hände, die in den Schützengräben niemals gezittert hatten, begannen zu beben. Er war ein Mann der Tat, nicht der Worte, gewohnt an Befehle und klare Anweisungen – aber nicht an die Aufmerksamkeit einer ganzen Menschenmenge.
„Ich... ich kann nicht...“ stammelte er, aber Martha drückte seine Hand. In ihren Augen lag kein Mitleid, sondern Stolz – Stolz auf seine Ehrlichkeit, seine Bescheidenheit, seine aufrechte Art.
„Geh schon,“ flüsterte sie, drückte seine Hand. „Zeig ihnen, wer du bist. Wird schon.“
Hermann grinste schief und flüsterte Linna zu: „Na, das wird interessant. Unser Willy als Bühnenheld.“ Aber in seiner Stimme lag auch Bewunderung – er wusste, dass er selbst niemals diese ehrliche Verlegenheit zeigen könnte.
Mit schweren Schritten, die noch den Rhythmus des Marsches in sich trugen, und einem Gesicht rot wie eine Tomate, stieg Willy die schmale Treppe zur Bühne hinauf. Das Scheinwerferlicht blendete ihn – so anders als das grausame Licht der Leuchtraketen über den Gräben. Seine Knie fühlten sich weich an, und er hätte am liebsten kehrtgemacht und wäre zurück zu seinem Platz gerannt. Doch der Drill der Armee half ihm – Befehl war Befehl, auch wenn es der Befehl eines Zauberers war.
Martha blickte ihm nach, als hätte sie ihn gerade neu kennengelernt. Ihre Hände zitterten leicht – ob vor Stolz oder Angst, wusste sie selbst nicht.
„Kaa Scheu, bester Mann!“ lachte Abrakadino, als Willy zögernd die Bühne betrat. „Wie haaß’n S’ eigentlich?“
„Willy... Willy Pongs. Infanterie-Regiment 28, 5. Kompanie,“ Die Antwort kam automatisch, wie beim Appell, aber seine Stimme klang heiser und unsicher. Der Schweiß perlte ihm von der Stirn.
„Und was treibn S’ eigentlich, Herr Pongs, im Theater – statt dass’s an Front’n das Vaterland verteidign?“
Willy kratzte sich am Nacken, seine Uniform fühlte sich plötzlich zu eng an. Der Schweiß stand ihm auf der Stirn. Alle starrten ihn an – die feinen Damen, die Offiziere, die Zivilisten. Seine Ehrlichkeit ließ ihn nicht lügen, auch wenn ihm die Wahrheit peinlich war. „Ech... ben op Hochtzeisreis“, brach es aus ihm heraus.
Ein erstes Kichern erhob sich aus dem Publikum. Willy wurde noch röter, aber er stand aufrecht da, die Schultern gerade – ein Soldat, der zu seiner Wahrheit stand.
„Jessas naa!“ rief Abrakadino, die Hand theatralisch ans Herz gepresst. „Dös is ja putzig! Und wo hockt denn d’ junge Dame, die Ihnen d’ Front ersetzt?“
Willy zeigte mit zitternder Hand in die zweite Reihe. „Do – dat es... mien Vrau Martha.“ Er schluckte schwer, aber seine Stimme wurde fester. „Nevve... nevve mien Schwiegermudder.“
In der Stille vor dem Lachen traf Willys Blick Marthas Augen – ihr stolzes Lächeln ließ ihn den Atem anhalten. Dann brach die Welle los.
Das Lachen wurde lauter und lauter, donnerte von den Wänden zurück, schien kein Ende zu nehmen. Sogar Hermann schüttelte den Kopf und grinste breit, während er Linna zuflüsterte: „Der Ehrliche! So etwas kann man nicht erfinden.“ Die Offiziere hielten sich die Seiten, die Damen fächelten sich Luft zu, und selbst die strenge Schwiegermutter konnte ein Lächeln nicht unterdrücken – zum ersten Mal sah sie in ihrem Schwiegersohn nicht den einfachen Arbeiter, sondern den aufrechten Mann, der ehrlich zu seinen Umständen stand.
Martha saß aufrecht da, ihre Augen strahlten vor Stolz. Während alle anderen lachten, sah sie nur ihren Mann – den ehrlichen, bescheidenen Willy, der lieber die Wahrheit sagte und sich lächerlich machte, als zu lügen. Das war der Mann, den sie geheiratet hatte. Das war der Mann, den sie liebte.
Willy stand da, seine Ohren glühten, seine Hände zitterten, und er wünschte sich nichts sehnlicher, als dass der Bühnenboden sich auftun und ihn verschlucken möge. Das Lachen schien eine Ewigkeit zu dauern. Er sah zu Martha hinüber, die ihm nicht mitleidig, sondern stolz zunickte – und plötzlich verstand er, dass sie ihn nicht trotz seiner Verlegenheit liebte, sondern wegen seiner Ehrlichkeit.
Abrakadino hob die Hand, als das Gelächter verebbte: „Meine Herrschaften! A Mann, der Eheweib und Schwiegamuata auf d’Hochzeitsreise mitnimmt – des is ka Mut, des is heroisch! Damit ham S’ scho des größte Wunder vollbracht!“
Neues Gelächter brandete auf, aber diesmal klang es freundlicher, fast liebevoll. Das Publikum lachte nicht mehr über Willy, sondern mit ihm. Willy entspannte sich ein wenig, auch wenn sein Gesicht noch immer brannte. Zum ersten Mal lächelte er sogar ein wenig.
Während Abrakadino seine Zaubertricks vorführte, nutzte Hermann die Ablenkung des verzauberten Publikums. Seine Finger bewegten sich geschickt und sicher – die Übung vieler Jahre. Zunächst die leichten Beuten: Die Dame in der ersten Reihe war völlig von der Vorstellung gefangen, als ihre Handtasche um einige Banknoten leichter wurde. Dabei streichelte er mit der anderen Hand Linnas Arm und flüsterte ihr zu: „Ist das nicht wunderbar, mein Schatz?“ Seine Stimme war voller Zärtlichkeit, seine Augen voller Liebe – und niemand ahnte, was seine geschickten Finger gerade getan hatten.
Doch dann fiel sein Blick auf etwas viel Verlockenderes – und viel Gefährlicheres.
In der Ehrenloge saß ein Hauptmann der Kavallerie, seine Ausgehuniform mit Orden übersät, die goldenen Litzen blitzend im Theaterlicht. An seiner Uniform glänzte eine kostbare Taschenuhr – ein Erbstück vermutlich, Gold und Silber, das ein Vermögen wert sein musste. Der Offizier war völlig in die Vorstellung vertieft, lehnte sich nach vorn, die Arme entspannt auf der Brüstung der Loge.
Hermann fühlte sein Herz schneller schlagen. Das war Wahnsinn – einen Offizier zu bestehlen, noch dazu während einer öffentlichen Veranstaltung. Wenn er erwischt würde... Kriegsgericht, Zuchthaus, vielleicht sogar Schlimmeres. Aber die Uhr war zu verlockend, und Hermann war noch nie ein Mann gewesen, der vor Risiken zurückgeschreckt wäre. „Entschuldige mich einen Moment, Liebling,“ flüsterte er Linna zu und küsste sie zärtlich auf die Wange. „Ich hole uns etwas zu trinken.“
Mit der Geschicklichkeit eines Geistes glitt er zur Seite der Loge. Als Abrakadino gerade Willy schweben ließ und das Publikum vor Staunen aufschrie, nutzte Hermann den Moment höchster Aufmerksamkeit. Seine Finger, geschult durch jahrelange Übung, arbeiteten blitzschnell. Die Uhrenkette war in Sekunden gelöst, die kostbare Uhr verschwand in seiner Tasche, bevor der Hauptmann auch nur ahnen konnte, was geschehen war.
„Hobn S’ halt die Händ’ empor...“ befahl Abrakadino, „...und denkn S’ an Ihr liabs Weiberl!“ Als Willy zu schweben begann, flüsterte er theatralisch: „Sehn S’ – wo d’ Liab ins Spiel kommt, da wird aa des Schwerste leicht!“ „Fesch gmacht, bester Mann!“ lobte Abrakadino, als Willy nach dem Schwebeakt verlegen nickte. „So an ehrlichen Helden hamm ma lang nimmer ghabt!“
Draußen im Saal brandete Applaus auf, als Abrakadino Willys Schweben beendete. „No also, meine Herrschaften!“ verkündete Abrakadino zum Finale. „In finsteren Zeiten sollt ma nie vergessn: Es gibt mehr Zwischenhimmel und Erd’, als unsre Schulweisheit sich träumt!“ Er ließ weiße Tauben aus seinem Zylinder aufsteigen. „Und denkn S’ dran – jedes ehrliche Herz is a bissl a Zauberer!“ Hermann nutzte den Lärm, um unauffällig zu seinem Platz zurückzugleiten.
Als er sich neben Linna setzte, zitterten seine Hände leicht vor Adrenalin. Er reichte ihr ein Glas Wasser. „Hier, mein Schatz,“ sagte er liebevoll und küsste ihre Hand. Linna warf ihm einen dankbaren Blick zu, völlig ahnungslos, was ihr charmanter Ehemann gerade getan hatte. Der Hauptmann würde den Verlust erst bemerken, wenn die Vorstellung längst vorbei war – und dann würde Hermann bereits wieder sicher zwischen den anonymen Massen der Kölner Straßen verschwunden sein.
Als Abrakadino Willy mit Hilfe eines raffinierten Apparats schweben ließ, war Hermann trotz seiner kriminellen Ablenkung beeindruckt. Der Trick war gut – sehr gut sogar. Aber er erkannte die Mechanik dahinter, die versteckten Drähte, die geschickte Ablenkung. „Bemerkenswert,“ murmelte er anerkennend. Ein Handwerker respektierte den anderen, auch wenn ihre Künste völlig unterschiedlich waren.
Willy spielte seine Rolle mit der gleichen Gelassenheit, mit der er Befehle ausführte, auch wenn die Peinlichkeit vom Anfang noch in seinen Wangen brannte. Jeder weitere Lacher des Publikums schien ihn ein wenig mehr zu entspannen, ein wenig weiter weg von den Schrecken zu führen, die er gesehen hatte – und von der beschämenden Erinnerung an sein Gestammel auf der Bühne. Als er unter donnerndem Applaus zu seinem Platz zurückkehrte, strahlte er wie ein Schuljunge, auch wenn er sich innerlich noch immer dafür schämte, wie er sich dort oben zum Gespött gemacht hatte. Martha sah ihn mit Augen an, die vor Stolz glänzten. „Dat wor jekämp, Willy. Ährlesch ze sin – en dä Welt.“ sagte sie und legte ihre Hand beschützend auf seine Schulter – genau wie auf dem Hochzeitsfoto.
Die Schwiegermutter nickte – das erste Mal an diesem Abend ohne Missbilligung. „Velleisch...“, murmelte sie, und ihre Stimme klang weicher als gewöhnlich, „velleisch bes de doch de Rischte för eus Martha. En Mann, dä ze seng Wohrheet steht, och wenn hä rod wie en Tommat es – dat es mieh, als mer vun ville annere sähe künne.“
Was geblieben war, war der Glanz des Abends – und die Ahnung, dass das Licht der Bühne bald vom Dampf des Bahnhofs verdrängt würde…
Doch als sie am nächsten Morgen zum Bahnhof gingen, fraß die Kälte jeden Trost weg.
Der Morgendunst hing schwer über den Gleisen des Kölner Hauptbahnhofs, vermischt mit dem beißenden Rauch der Dampflokomotiven und dem Geruch von Kohle und Metall. Die Luft war kalt und feucht, und auf den Schienen glitzerten Tautropfen wie winzige Tränen. Überall drängten sich Menschen in der Morgendämmerung – Soldaten mit schweren Rucksäcken und müden Gesichtern, weinende Frauen in dünnen Mäntel, Kinder, die sich frierend an die Röcke ihrer Mütter klammerten. Der Krieg hatte auch die Bahnhöfe verändert: Die Bänke waren entfernt worden, um mehr Menschen Platz zu machen, die Fenster der Wartehalle waren vernagelt, und überall hingen Plakate: „Kauft Kriegsanleihen!“ und „Gott strafe England!“
Der Dampf der Lokomotiven vermischte sich mit dem Nebel über Gleis 7. Willy stand in seiner frisch gebürsteten Uniform vor dem wartenden Zug. Es war kein gewöhnlicher Personenzug, sondern ein Transport für Soldaten: abgeschabte Waggons ohne Fenster, nur schmale Lüftungsschlitze, aus denen der Geruch von Schweiß und Angst kroch. In diesen dunklen Kästen würde er zurück nach Flandern rumpeln – mit hunderten anderen, deren Gesichter schon das Grauen vorwegnahmen.
Marthas Hände umklammerten Willys raue Finger, als könne sie ihn dadurch am Bleiben zwingen. In ihren Augen lag ein ganzer Ozean unausgesprochener Ängste.
„Hier, Willy.“ Sie drückte ihm das in Zeitung gewickelte Päckchen in die Hand. „Dat letzte Stöck Speck vun jestern… un Brot, dat ech gedört han.“ Ihre Stimme kratzte wie Kohle auf Blech. „Iß et nit op einmohl, hä? Denk an mich, wenn de’s deihs.“
Willys Kehle war wie zugeschnürt. In Willys Jackentasche wärmte sich das kleine Päckchen, das Martha ihm gegeben hatte – darin lag nicht nur Speck, sondern ein ganzes Jahr ihres Verzichts.
„Martha…“, murmelte er und zog sie an sich. Ihr Haar roch nach Lavendel und Kohle, ein Duft, der ihn durch die Schützengräben begleiten würde. „Ech koom heem, versproche. Un dann make mer e Hus. Met nem Joaden.“ Sie presste ihr Gesicht an seine Uniformjacke, um das Schluchzen zu ersticken. „Hald dich joot, Willy. De bes mien halve Wunner – ech well dat janze.“
Über ihnen kreischte eine Dampfpfeife. Die letzten Soldaten stiegen ein. Plötzlich eine raue Stimme hinter Willy: „Pongs? Dä Pongs, Willy, bes dat dr?“ Ein Mann mit einer Narbe über der linken Augenbraue und hohlen Wangen trat aus dem Qualm. Kürtens, Jupp – sie hatten 1915 zusammen in der Bajonett-Ausbildung gelegen. „Jupp! Jooh, leever Gott! Wie geiht et die?“ Jupp’ Lächeln war bitter. „Jrete es dot. Schpanesch Jripp, vör zwei Moohnde.“ Er zog ein verblichenes Foto seiner Verlobten aus der Tasche. „Un do? Hüre em Kresch… jekämp.“ Willy legte eine Hand auf Marthas Arm. „Martha, dat es Jupp. Mer hann zosamme…“ „…Schlamm jefrasse bei Ypern“, beendete Jupp den Satz. Seine Augen wurden fern. „Mer moe sich frore, ob mer noh Fräde levve künne.“ Er klopfte Willy auf die Schulter. „Ävver do häss en Jrond, dorschzekumme. Hald en fess, Kamerad.“ Ein Pfiff des Zugführers riss sie auseinander. „Velleisch see mer öns drövve widder. Pass op dien Seel op, Willy. Nit bloß dien Liff.“ Willy nickte stumm, während Jupp im Gedränge verschwand. Die Worte hingen schwer zwischen ihm und Martha.
Am anderen Ende des Bahnsteigs zerrte Linna an Hermanns Ärmel, ihre Stimme ein scharfes Flüstern:
„En Uhr?“
„Un du säß et mir erst jetz?!“
Ihr Gesicht war aschfahl.
Hermanns Charme wirkte wie abgeblätterter Lack. „Beruhige dich, Schatz! Ein harmloser…“ „Härmlesch?“ Sie stieß seinen Arm weg. „Dä Mann, dem de se jestohle häss – hä es Kriminalbolizist! Ech hann et an senger Ahzeeschekett jesehn, als hä noh der Uhr jreef!“ Ihre Augen weiteten sich vor Panik. „Se dorschsoeke dä Bahnhof. Sühs de dä Männer am Ußjang?“ Hermann folgte ihrem Blick. Zwei Männer in Zivil, die Hände in den Manteltaschen, musterten die Menge. Seine lässige Haltung fiel von ihm ab. „Verdammt“, zischte er. „Mer möße hee fott. Siggklik.“„Wohin? Dä Zug noh Jladbach fährt erst en en Stond! Un wenn se die fenge…“ Linnas Finger krallten sich in seinen Mantel. „Hermann, dat es kein Spell mieh!“ Er packte ihr Handgelenk, nicht zärtlich, sondern hart. „Dann spell met, Linna. Lächele. Do so, als wör all joot.“ Er strich über die Uhr in seiner Tasche, während sein Blick suchend über die Schilder huschte – Jepäckopbewahrung, Toilette, Ußjang Ost…
Sie nehmen ihn mir wieder. Genau wie sie uns den Speck, das Licht, das Lachen nehmen. Wie lange, Gott? Wie viele Abschiede hält ein Herz aus? Sie spürte den Druck von Willys Hand, aber ihre Gedanken rasten: Hermanns bleiches Gesicht, Linnas verzweifelte Augen… Was haben sie getan? Und wenn Willy erfährt, dass sein Schwager ein… Sie schloss die Augen. Nein. Konzentrier dich auf ihn. Auf diesen Atemzug, diesen Blick. Sie strich über das Zeitungspapier in Willys Hand. Jeder Krümel war ein Gebet. Lass ihn sie essen. Lass ihn heimkommen. Plötzlich sah sie ihre Mutter vor sich, wie sie den Kopf geschüttelt hatte: „Dä Pongs, Willy? En Schneijer?“ Jetzt, mit dem Geruch von Schmieröl und Verzweiflung in der Nase, verstand sie: Seine Einfachheit war ein Anker. In einer Welt, die log und stahl, war seine Verlegenheit auf der Bühne ihre Rettung gewesen. „Ech hann dich lev, Willy“, dachte sie so intensiv, dass sie hoffte, er könne es hören. „Nit troz Ypern. Weil do wohrs un immer Minsch jeblève bes.“
Der letzte Ruf erschallte:
„Einsteigen! Alle einsteigen!“
Willy riss sich los, presste Martha an sich. „Schrief mer! Jeden Dach!“ Sein Kuss schmeckte nach Salz und Abschied. Dann stieg er auf die Trittstufe des Waggons. Die Tür des Soldatenwaggons schloss sich mit metallischem Krachen.
Martha spürte, wie ihre Knie nachgaben, als der Zug sich in den Nebel fraß. Doch dann griff sie in ihre Tasche – Willys letztes Brot. Sie presste das Päckchen an sich, als wäre es sein Herz.
Durch den schmalen Lüftungsschlitz des Waggons suchten sich ihre Blicke. Für einen Sekundenbruchteil war da nur Stille. Dann setzte sich der Zug ruckend in Bewegung.
Hermann zerrte Linna hinter einem Gepäckwagen hervor. „Do! Dä Jöterzoch op Jleis 3 – dä fährt noh Norde!“ Er schob sie vor sich her. „Siggklik! Ieh dä noch kumme...“
Ein Schatten fiel über sie. Ein Mann in abgetragenem Trenchcoat, die Hände in den Taschen. „Hermgens, Hermann? Se kumme besser met.“ Seine Stimme war leise wie ein Messer.
Hermann erstarrte. Neben ihm begann Linna leise zu weinen – nicht aus Angst, sondern aus Scham. Ihre Träume von einem ehrlichen Leben zerbrachen im Quietschen der Räder und dem Schrei einer Lokomotive, die Willy in den Krieg trug.
 1x
1x