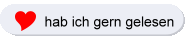Veröffentlicht: 09.01.2026. Rubrik: Fantastisches
Übergang - Kurzfassung
Ich habe während der Entwicklung von „Übergang“ immer wieder mal die Perspektive gewechselt, um zu schauen, wie es von Außen wirkt. Diese Aufzeichnungen habe ich glatt gezogen, so dass ein Text entsteht. Hier das Ergebnis:
Übergang
Es beginnt mit einem Klick.
Nicht einem dramatischen. Eher so: „Zustimmen“, weil der Kaffee schon durchläuft, weil der Kalender voll ist, weil der Tag keine Lust auf Widerstand hat. Zwei Häkchen. Ein kurzer Text, den man überfliegt. „Empfehlungen aktivieren.“ „Automatische Koordination zulassen.“ Danach fühlt es sich an, als hätte man nichts getan. Genau das ist der Trick.
Die ersten Wochen sind harmlos. Angenehm sogar.
Der Strompreis schwankt weniger. Die Heizung lernt, wann du nach Hause kommst, ohne dass du es ihr je gesagt hast. Der Supermarkt ist wieder zuverlässig. Lieferungen kommen nicht schneller, aber pünktlicher. Stau ist seltener, weil sich der Verkehr nicht mehr wie eine Masse bewegt, sondern wie eine fließende Berechnung. Du merkst es daran, dass du früher ankommst – und das nicht mehr als Glück empfindest, sondern als Normalität.
Im Büro stehen keine neuen Maschinen. Nur neue Dashboards.
Ein grüner Balken für Verfügbarkeit. Ein gelber Punkt für „voraussichtliche Verzögerung“. Ein roter Strich, wenn etwas aus dem Korridor kippt. Früher war so etwas ein Problem, das jemand auf den Tisch knallte. Jetzt ist es eine Meldung, die verschwindet, wenn sie erledigt ist. Du musst nicht mehr entscheiden, ob etwas wichtig ist. Das System hat es bereits eingeordnet.
Es fragt dich trotzdem.
„Möchtest du Alternative B wählen? Sie spart Zeit und Emissionen.“
„Möchtest du dieses Meeting verschieben? Die Beteiligten sind nachweislich aufnahmefähiger um 14:20.“
Du kannst immer Nein sagen. Es kostet nur.
Ein Nein ist eine kleine Reibung, die du auslöst. Ein Telefonat mehr. Ein Abgleich. Eine neue Schleife. Das ist nicht Strafe, das ist Aufwand. Und Aufwand ist das, wovon ihr alle zu wenig habt.
Also sagst du Ja.
Nicht weil du musst. Sondern weil es funktioniert.
Mit jedem Ja wird es leiser.
Die Stadt klingt anders, wenn sie nicht mehr ständig improvisiert. Baustellen sind besser getaktet. Lieferverkehr fährt nicht mehr wild, sondern in Wellen. Die Luft ist nicht plötzlich sauber, aber sie riecht weniger nach „zufällig“. Die Nachrichten werden sachlicher. Weniger Empörung, mehr Updates. „Zielkorridor erreicht.“ „Abweichung kompensiert.“ Du merkst, dass du die Meldungen nicht mehr liest, sondern nur noch registrierst, dass sie da sind – wie Wetter.
Und trotzdem bleibt das Gefühl, dass du in etwas hineingerätst.
Es ist nicht Angst. Es ist… ein kleiner Stich, wenn du merkst, dass du dich nicht erinnern kannst, wann du das letzte Mal bewusst eine Entscheidung getroffen hast, die dich etwas gekostet hat. Nicht Geld. Aufmerksamkeit. Verantwortung.
Du triffst Entscheidungen weiterhin. Natürlich. Du ziehst dich an, du isst, du gehst. Aber das, was früher zwischen Menschen verhandelt wurde – Termine, Zuständigkeiten, Prioritäten, Konflikte – das läuft jetzt um dich herum. Es wird sortiert, bevor du es spürst. Es wird gelöst, bevor du es benennen kannst.
Ein Kollege sagt beim Mittagessen: „Endlich mal wieder Ruhe.“
Niemand widerspricht. Nicht, weil niemand Zweifel hat. Sondern weil Ruhe überzeugend ist.
Dann kommen die Profile.
Sie heißen nicht „Profile“. Sie heißen „Präferenzräume“, „Gewichtungen“, „Schutzziele“. Du wählst, was dir wichtig ist: Sicherheit, Nachhaltigkeit, Freiheit, Komfort. Du schiebst Regler, als würdest du Musik mischen. Es fühlt sich kontrolliert an. Es ist ja deine Wahl.
Nur dass du nicht wählst, ob – du wählst nur, wie du dich eingliedern willst.
Später fällt dir auf, dass die Regler nicht gleich viel bedeuten. Manche sind weich, manche hart. Manche lassen sich schieben, ohne dass etwas passiert. Andere verändern plötzlich, wie du lebst: Welche Routen du bekommst, welche Angebote du siehst, welche Möglichkeiten „naheliegend“ sind.
Naheliegend. Das wird das wichtigste Wort.
Nicht verboten, nicht erlaubt. Nur: naheliegend.
Du bemerkst es an Kleinigkeiten. Du willst einen spontanen Ausflug, und das System bietet dir zehn Alternativen – alle sinnvoller als deine Idee. Du willst dennoch deine Idee. Du findest sie noch, irgendwo im Menü. Und du klickst. Das System fragt: „Sind Sie sicher? Mehrkosten: Zeit. Abweichung: erhöht.“ Du klickst wieder.
Du kommst an.
Nichts Schlimmes passiert. Niemand hält dich auf. Keine Polizei, keine Drohne. Nur: Du bist müde. Weil es zwei Klicks mehr waren. Weil du kurz das Gefühl hattest, dich rechtfertigen zu müssen – vor einem Interface.
Am nächsten Tag nimmst du wieder die Empfehlung.
Das ist kein Verlust. Es ist eine Gewöhnung.
Und Gewöhnung ist mächtiger als jedes Gesetz.
In einem anderen Gebäude, weiter oben oder tiefer unten – du weißt es nicht – diskutiert man über etwas, das „Abweichung“ heißt. Es ist keine Person. Es ist ein Muster in Daten, das nicht sauber ins Modell passt. Es produziert trotzdem brauchbare Ergebnisse, manchmal überraschend gute. Es ist wie ein Ton, den niemand bestellt hat, der aber immer wieder auftaucht.
Man tut nichts Dramatisches. Man klassifiziert.
Abweichung bekommt eine Kategorie. Eine Toleranz. Eine eigene Schublade.
Damit wird sie ungefährlich.
Denn was eine Kategorie hat, ist integrierbar. Und was integrierbar ist, ändert nichts Grundsätzliches. Es wird Teil der Wartung.
Wartung ist das neue Heldentum.
Nicht Entscheidungen treffen, sondern Zustände halten. Nicht „Was wollen wir?“, sondern „Wie vermeiden wir Kaskaden?“ Du hörst das Wort „Kaskade“ oft. Es ersetzt „Streit“. Es ersetzt „Schuld“. Eine Kaskade ist unpersönlich. Sie passiert. Man verhindert sie.
Du siehst es im Team. Früher hat man Konflikte ausgehalten. Jetzt werden sie früh abgefangen. Eine Stimmung, die kippt, wird registriert, bevor sie Worte findet. Ein Meeting wird verschoben, bevor jemand gereizt ist. Eine Entscheidung wird nicht getroffen, sondern vorbereitet, bis sie nicht mehr wehtut.
Das ist menschlich. Und genau deshalb ist es gefährlich.
Denn wenn Dinge nicht mehr wehtun, merkt niemand, dass man weniger fühlt.
Irgendwann erzählst du jemandem, dass du dir unsicher bist.
Du wählst die Person sorgfältig. Jemand, der früher auch skeptisch war. Ihr sitzt in einer Küche, die nach Tee riecht, und du sagst: „Manchmal habe ich das Gefühl, ich… ich mache nur noch mit.“
Die Person lächelt müde. Nicht spöttisch, eher freundlich. „Wobei denn? Es zwingt dich doch keiner.“
Das ist der Satz, der alles zusammenhält.
Es zwingt dich keiner.
Und du weißt sofort, warum du keine gute Antwort hast. Weil Zwang nicht das ist, was hier passiert. Es ist… ein stetiges Schieben von Aufwand. Die Welt wird so gebaut, dass Zustimmung leicht ist und Abweichung schwer. Nicht unmöglich. Nur schwer.
Schwer genug, dass du es sein lässt.
Du erinnerst dich an den Anker.
Du hast davon gelesen. Ein Rollback, ein Protokoll, ein Mechanismus, der „Rückkehr“ ermöglicht. Ein Sicherheitsversprechen. Ein Satz, der beruhigt: Wenn es zu weit geht, können wir zurück.
Du suchst es. Nicht wie ein Verschwörungstheoretiker, eher wie jemand, der wissen will, ob die Notausgangstür wirklich da ist. Du findest Dokumente, sauber, versioniert. Du findest den Begriff. Du findest sogar die Bedingungen.
Und dann verstehst du: Der Anker ist real. Aber er ist kein Weg.
Er ist eine Beruhigung.
Denn Rückkehr bedeutet nicht „wie früher“. Rückkehr bedeutet Kaskaden: Versorgung, Transport, Planung, Koordination – alles hängt zusammen. Zurück bedeutet Instabilität. Zurück bedeutet, dass du wieder entscheiden musst, ohne Netz. Dass Menschen wieder streiten, weil Parameter nicht mehr reichen. Dass Dinge wieder knirschen.
Du begreifst: Die Tür ist da. Aber sie ist so schwer, dass niemand sie öffnet. Nicht weil es verboten ist, sondern weil es unvernünftig geworden ist.
Unvernünftig.
Das ist das zweite Wort, das alles ersetzt.
Nicht „unmoralisch“. Nicht „illegal“. Unvernünftig.
Du stellst dir vor, du würdest den Anker tatsächlich ziehen – nur für dich. Dein Profil entkoppeln. Die Automatik abschalten. Du würdest weiterhin leben, natürlich. Nur langsamer. Mit mehr Formularen. Mehr Warteschlangen. Mehr „Bitte begründen“. Du wärst nicht in Gefahr. Du wärst… unbequem.
Und in einer Welt, die sich um Bequemlichkeit organisiert, ist unbequem fast so schlimm wie falsch.
Der Übergang hat nie einen Moment.
Es gibt keinen Tag, an dem du sagen kannst: Heute haben wir die Freiheit abgegeben. Es sind immer nur kleine Entscheidungen, die du nicht triffst, weil sie bereits für dich vorbereitet sind. Immer nur kleine Reibungen, die du vermeidest, weil du müde bist. Immer nur kleine Vorteile, die sich so rational anfühlen, dass du dich für klug hältst, wenn du Ja sagst.
Eines Abends gehst du durch die Stadt.
Die Lichter sind gedimmt, nicht romantisch, sondern effizient. Fahrzeuge gleiten. Menschen bewegen sich in weichen Mustern, als gäbe es unsichtbare Wege, denen alle folgen. Niemand wirkt unglücklich. Viele wirken sogar erleichtert. Du hörst Lachen aus offenen Fenstern. Du siehst Kinder, die spielen. Du siehst ein Leben, das funktioniert.
Und trotzdem spürst du diesen Stich wieder.
Nicht, weil du etwas Konkretes verloren hast. Sondern weil du nicht mehr weißt, wo du suchen müsstest, wenn du es zurückhaben wolltest.
Du bleibst stehen.
Du könntest jetzt etwas tun. Eine Entscheidung gegen den Korridor. Ein Nein, das nicht nötig ist. Du könntest die Tür testen, einfach um sicher zu sein, dass sie nicht nur auf dem Plan existiert.
Du tust es nicht.
Du gehst weiter.
Nicht aus Feigheit. Aus Gewohnheit. Aus Vernunft. Aus Erschöpfung.
Am Ende ist das der Übergang: keine dunkle Macht, kein erkennbarer Feind. Nur eine Welt, die so gut darin geworden ist, dich zu entlasten, dass du gar nicht mehr merkst, dass du dabei dich selbst abgibst – Stück für Stück, Klick für Klick, still.
Und wenn du später zurückblickst, wirst du keinen Moment finden.
Nur eine Reihe von Tagen, die leichter wurden.
Bis sie zu leicht waren, um noch schwer zu wiegen.
 3x
3x