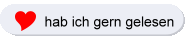Veröffentlicht: 04.02.2026. Rubrik: Historisches
Auswanderung nach Amerika
Die Morgendämmerung brach über die endlosen Wälder des königlichen Forstes Ruda wie ein silberner Schleier. Zwischen den hohen Tannen und Birken, wo der Tau noch schwer auf den Zweigen lag, bewegte sich eine Gestalt so lautlos wie der Nebel selbst. Michal Jendrian, ein Mann von 36 Jahren mit wettergegerbten Händen und Augen, die die Farbe des Waldes trugen, kannte jeden Pfad, jeden Tierwechsel, jeden Baum in diesem weitläufigen Revier.
Er war kein Wilderer aus Lust am Verbrechen. Die Armut hatte ihn dazu gemacht. Als Tagelöhner in Zdroje, einem abgelegenen Straßendorf an der preußisch-russischen Grenze, verdiente er kaum genug, um seine Frau Zosiu und die beiden kleinen Töchter Pelusia und Wladzia zu ernähren. Wenn der Roggen knapp wurde, wenn die Kartoffeln in den sandigen Böden verfaulten, wenn die Winter zu lang und die Sommer zu kurz waren, dann wurde der Wald zu seiner Speisekammer.
An diesem Herbstmorgen des Jahres 1903 schlich er durch das Unterholz, seine Schritte kaum hörbar im feuchten Laub. Das Mondlicht war schwach wie ein dünner Silberstrich am Himmel, und der Frost ließ seinen Atem in kleinen Wölkchen aufsteigen. Seine selbst geschnitzten Fallen lagen bereit in seinem groben Leinensack, und seine Finger, trotz der Kälte geschickt und sicher, setzten sie an den Stellen, wo er die Spuren der Hasen im weichen Erdreich gelesen hatte.
Plötzlich zerbrach ein Ast hinter ihm mit einem Knall, der durch die Stille des Waldes schnitt wie ein Pistolenschuss.
„Jendrian!“ Die Stimme des Oberförsters war hart wie Stahl und kalt wie das Eis auf den Pfützen.
Michal wirbelte herum, das Herz pochte ihm bis zum Hals. Der Uniformierte stand nur wenige Meter entfernt, die Messingknöpfe seiner Dienstjacke glänzten im schwachen Licht, und seine Augen waren wie zwei dunkle Löcher in dem bleichen Gesicht.
„Ich weiß genau, was du hier treibst“, sagte der Oberförster. „Beim nächsten nächtlichen Streifzug bist du fällig – das Zuchthaus in Thorn wird dein neues Zuhause. Deine Frau, deine Kinder können dann sehen, wie sie allein zurechtkommen.“
Michal schwieg, senkte den Kopf, doch in seinem Inneren kochte es wie Wasser über offenem Feuer. Ein Schritt weiter - nur ein einziger Schritt - und der Förster hätte ihn mit den Fallen in der Hand erwischt. Dann wäre es vorbei gewesen mit der Freiheit, vorbei mit allem.
Als er später durch die schlammigen Gassen des Dorfes nach Hause ging, die Stiefel schwer vom feuchten Lehm, wartete Zofia bereits an der niedrigen Holztür ihrer einfachen Bauernkate. Das Kerzenlicht hinter ihr ließ ihr Gesicht wie aus Porzellan erscheinen, doch ihre Augen verrieten die Angst, die sie plagte.
„Michale…“ flüsterte sie, griff nach seinen kalten Händen. „Przestań, proszę cię. Hör auf. Sie nehmen dich mit… und wir, zostaniemy sami.“
Er blickte sie an, sah die Sorgenfalten. Hinter der dünnen Wand das leise Atmen der Kinder.
„A co mamy jeść, Zosiu? Powietrze?“ – „Und wovon sollen wir leben, Zosia? Von Luft?“
Sie schwieg, weil sie keine Antwort wusste. Beide wussten sie, dass die Armut sie umschloss wie ein eiserner Ring, aus dem es kein Entrinnen gab. Nicht hier, nicht in Zdroje, nicht in diesem Leben aus Sand und Entbehrung.
Von diesem Tag an ging Michal nur noch selten in den Wald, und wenn, dann mit dem Gefühl, dass unsichtbare Augen ihn verfolgten. Die Angst wuchs in ihm wie eine Krankheit, und mit ihr die Gewissheit: Er musste weg. Nicht nur wegen der Armut. Sondern weil das Land ihn nicht mehr wollte, weil er hier zu einem Gejagten geworden war.
Die Briefe aus Amerika, die sein Schwager Franciszek vorlas, sprachen von einer anderen Welt. Jozef Krygier, der Ehemann von Zofias Tante Weronika, schrieb aus einem Ort namens Nanticoke in Pennsylvania: „Hier gibt es Arbeit für starke Männer. Die Kohlegruben brauchen Arbeiter. Wer nicht faul ist, kann Geld verdienen.“
Der Abschied im Frost
Der 11. Januar 1904 war ein Tag, an dem der Frost so scharf war, dass er die Fensterscheiben mit dicken Eisblumen überzog und die Atemluft in der Luft zu kleinen Kristallen erstarren ließ. Michal stand vor seinem kleinen Holzhaus und blickte ein letztes Mal über die weiten Felder, die unter einer dicken Schneedecke lagen wie unter einem weißen Leichentuch.
Zofia hielt seine Hand fest, so fest, als könne sie ihn dadurch zurückreißen in ihr gemeinsames Leben.
„Michal…“ sagte sie, ihre Stimme kaum mehr als ein Hauch. „Wenn sie dich suchen – uciekaj, geh und komm nicht wieder.“
Er sah in ihre Augen, diese dunklen Augen, in die er sich vor fünf Jahren verliebt hatte, als sie noch ein Mädchen war, das beim Tanz in Gorzno lachte.
„Wrócę… Ich komme wieder. Ale jako wolny człowiek – als freier Mann.“
Im Haus küsste er seine Töchter. „Dobranoc, Pelusiu… Dobranoc, Wladziu…“ flüsterte er. Pelusie murmelte „Tata…“ im Schlaf.
Als er in die Kälte des winterlichen Morgens hinaustrat, seinen Leinensack über der Schulter, wusste er bereits, dass der Weg lang und unerbittlich sein würde.
„Michal...“ Zofias Stimme wurde vom Wind verschluckt.
„Nigdy was nie zapomnę – niemals vergesse ich euch“, rief er ohne sich umzudrehen in den Wind, „und ich komme zurück.“
Der Weg zum Bahnhof von Radosk führte durch verschneite Felder und gefrorene Wälder. Seine Stiefel knirschten im Schnee, und mit jedem Schritt entfernte er sich weiter von allem, was ihm lieb und vertraut war. Die Kälte kroch durch seine Kleidung bis auf die Haut, doch die Kälte in seinem Herzen war noch schneidender.
Berlin-Ruhleben: In den Baracken des Wartens
Nach einer endlos scheinenden Reise über Thorn und Posen erreichte Michal am Abend des 11. Januar 1904 Berlin. Der Schlesische Bahnhof war ein Hexenkessel aus Stimmen, Sprachen, Dampf und Menschenmassen. Auswanderer aus ganz Osteuropa strömten hier zusammen: Polen, Russen, Litauer, Juden - alle vereint in der Hoffnung auf ein besseres Leben jenseits des Atlantiks.
In der Auswandererhalle des Bahnhofs fand Michal ein Bett zwischen zweihundert anderen verzweifelten Seelen. Das Brot war hart wie Stein, der Kaffee schwarz wie Pech, aber es war warm, und niemand fragte nach seiner Vergangenheit.
Am nächsten Morgen brachte ihn ein Zug nach Ruhleben, wo die HAPAG ihre Auswanderer wie Vieh in Baracken zusammenpferchte. Hier begann das eigentliche Martyrium. Ärzte in weißen Kitteln untersuchten ihn wie ein Tier: Sie zogen seine Augenlider zurück, horchten sein Herz ab, betasteten seine Lymphknoten.
„Gesund genug“, murmelte ein Arzt auf Deutsch und machte ein Kreuz auf einer Liste.
Michal verstand kaum ein Wort, aber er wusste: Das bedeutete Weiter, das bedeutete Amerika, das bedeutete Hoffnung.
Im Schlafsaal, wo hartes Brot und schwarze Brühe die einzige Nahrung waren, sprach ihn ein anderer Auswanderer an, ein Mann aus Galizien mit einem Gesicht, das von Sorgen gezeichnet war wie ein zerknittertes Blatt Papier.
„Bratku, boisz się?“ fragte ihn der Mann aus Galizien.
Michal nickte stumm.
„Każdy się boi… Alle haben Angst. Aber w Ameryce – da ist chleb, Brot, für alle.“
Hamburg, Ballin-Stadt: Das Tor zur neuen Welt
Hamburg empfing die Auswanderer mit einem eisigen Wind, der von der Elbe her wehte und durch die Kleidung schnitt wie Messerklingen. In der Ballin-Stadt, dieser riesigen Ansammlung von Hallen und Baracken auf der Veddel, roch es nach nassem Holz, Teer, Desinfektionsmitteln und dem Schweiß tausender Menschen.
Michal, der Analphabet, wurde geführt wie ein Tier durch die Schleusen der Zivilisation: Entlausung, Dampfkammer, Schrubbürste. Nackt stand er mit dutzenden anderen Männern in einem gefliesten Raum, während ihre Kleidung dampfend desinfiziert wurde. Viele lachten nervös, andere schämten sich still. Der Geruch von Chlor und heißem Dampf ließ die Augen tränen.
Ein Aufseher in Uniform brüllte über den Lärm der Dampfmaschinen hinweg: „Schneller, schneller! Ihr wollt doch nach Amerika, oder?“
Michal presste die Lippen zusammen und schloss die Augen. Ja, er wollte nach Amerika - aber um welchen Preis?
Bei der Registrierung wurde aus „Michal Jendrian“ plötzlich „Michal Jendreson“. Der Beamte mit der Goldbrille sprach gebrochenes Polnisch und schrieb die Namen so, wie er sie zu verstehen glaubte. Michal konnte nicht lesen, konnte nicht protestieren. Er war nur noch eine Nummer in den Listen der HAPAG: 17.412/04.
Die „Belgravia“: Zwischendeck im Winter
Am 15. Januar 1904, bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, ging Michal an Bord der „Belgravia“. Das Schiff lag an der Überseebrücke wie ein schwimmender Berg aus Stahl und Holz. Rauch stieg aus ihren vier Schornsteinen auf und mischte sich mit dem grauen Hamburger Himmel.
Das Zwischendeck, in das er zusammen mit 866 anderen Auswanderern gepfercht wurde, war ein Reich der Schatten. Die Decke war so niedrig, dass ein erwachsener Mann sich bücken musste. Die Luft war feucht und stickig, erfüllt vom Geruch ungewaschener Körper, von Erbrochenem, von Angst und Hoffnung.
Michals Schlafplatz war eine schmale Holzpritsche zwischen den Kohlenbunkern und den Pferdeboxen. Das Gepäck der Passagiere stapelte sich in den Gängen, Kinder weinten, Mütter sangen Wiegenlieder in fremden Sprachen, alte Männer beteten halblaut.
Im Zwischendeck sangen Frauen: „Święta Mario, módl się za nami…“
Ein litauischer Bauer stöhnte: „Bratku… jeśli tu umrzemy – wenn wir hier sterben, kto będzie wiedział? Wer wird es wissen?“
Michal presste die Lippen zusammen. „Jezu, Maryjo…“ flüsterte er.
Als die „Belgravia“ am 17. Januar in Boulogne-sur-Mer noch weitere Passagiere aufnahm und dann endlich in den offenen Atlantik hinausfuhr, begann für Michal eine Reise durch die Hölle.
Der Winter 1904 war einer der kältesten in der Geschichte des Nordatlantiks. Stürme peitschten das Schiff wie einen Korken auf den haushohen Wellen. Wasser tropfte von den Decken, die Öfen im Zwischendeck wurden aus Sicherheitsgründen abgestellt, und die Kälte kroch durch die Ritzen der Schiffswände wie ein lebendiges Wesen.
Die Seekrankheit erfasste fast alle Passagiere. Michal lag tagelang auf seiner nassen Pritsche, der Magen verkrampfte sich schmerzhaft, und immer wieder musste er sich über die überfüllten Blecheimer beugen. Neben ihm weinte ein Kind unaufhörlich, und eine Mutter wiegte ihren toten Säugling in den Armen.
Ein böhmischer Bauer, der dicht neben ihm lag, stöhnte in der Dunkelheit: „Wenn wir hier sterben, Bruder, wer wird es wissen?“
Michal schwieg. Er schloss die Augen und sah vor sich das Gesicht seiner Frau, die kleinen Hände seiner Töchter. Dieses Bild hielt ihn am Leben, wenn die Verzweiflung ihn zu verschlingen drohte.
Die Mahlzeiten im Zwischendeck waren eine Farce. Morgens gab es wässrigen Kaffeeersatz und hartes Brot. Mittags eine dünne Suppe mit Kartoffeln und gelegentlich einem Stückchen Salzfleisch. Abends wieder Brot und lauwarmen Tee. Die meisten konnten ohnehin nichts bei sich behalten.
Sonntags hielt ein Priester Gottesdienst, soweit das bei dem Gestank und Lärm möglich war. Seine Worte gingen unter in dem Knarren der Planken, dem Heulen des Windes und dem Stöhnen der kranken Menschen.
Vierzehn Tage lang dauerte diese Tortur. Vierzehn Tage, in denen Michal mehr als einmal dachte, er würde sterben, ohne seine Familie jemals wiederzusehen.
Ellis Island: Das Tor zur Freiheit
Am Morgen des 30. Januar 1904 erwachte Michal vom Schweigen. Die „Belgravia“ schaukelte sanft in ruhigem Wasser. Durch die kleinen Bullaugen fiel Licht, und jemand rief: „New York! Amerika!“
Die Auswanderer drängten sich an Deck, starrten auf die riesige Silhouette Manhattans, die sich vor ihnen aus dem Wasser erhob wie ein Gebirge aus Stein und Glas. Die Freiheitsstatue grüßte sie mit erhobener Fackel - ein Anblick, der selbst den härtesten Männern Tränen in die Augen trieb.
Doch die Freiheit war noch nicht erreicht. Erst kam Ellis Island, die berüchtigte Insel, auf der sich das Schicksal jedes Einwanderers entschied.
Die medizinische Untersuchung war gründlicher als alles, was Michal bisher erlebt hatte. Ärzte suchten nach Trachom, einer Augenkrankheit, die zur sofortigen Abschiebung führte. Sie horchten Herz und Lunge ab, untersuchten die Haut nach Krätze und anderen ansteckenden Krankheiten.
Michal hatte Glück. Kein Kreidezeichen wurde auf seine Kleidung gemalt, das bedeutete hätte, dass etwas nicht stimmte.
Die Befragung fand mit Hilfe eines Dolmetschers statt, eines gewissen John Kowalski aus Krakau, der müde und gelangweilt die immer gleichen Fragen stellte.
Der Dolmetscher stellte Fragen:
„Jak się nazywasz?“ – „Michal Jendrian.“
„Skąd jesteś?“ – „Zdroje, Westpreußen.“
„Dokąd jedziesz?“ – „Nach Nanticoke, zu Jozef Krygier.“
„Pieniądze?“ – Michal zog drei zerknitterte Dollar-Scheine aus seiner Tasche - alles, was von seinem bescheidenen Ersparten übrig war. „Drei Dollar“, sagte der Dolmetscher zum amerikanischen Beamten.
Der Beamte runzelte die Stirn. Drei Dollar waren wenig, sehr wenig. Aber Michal hatte eine Adresse, einen Kontakt, jemanden, der für ihn bürgte. Das reichte.
In der Einreiseliste wurde aus „Michal Jendreson“ nun „Mihaly Jendreton“. Wieder ein neuer Name für einen Mann, der schon nicht mehr wusste, wer er wirklich war.
Am Nachmittag setzte ihn die Fähre in Hoboken, New Jersey, ab. Er verbrachte die Nacht in einer Baracke des HAPAG-Terminals, zusammengepfercht mit anderen Auswanderern, die wie er nicht wussten, was der nächste Tag bringen würde.
Nanticoke: Die Hölle auf Erden
Die Zugfahrt nach Pennsylvania führte durch eine Landschaft, die Michal fremd und feindlich erschien. Wo er erwartet hatte, grüne Wälder und friedliche Dörfer zu sehen, erstreckte sich ein Alptraum aus Rauch, Schmutz und Industrieanlagen. Die Kohlereviere von Pennsylvania glichen einem gigantischen Schlachtfeld, auf dem Menschen und Maschinen gegeneinander kämpften.
Nanticoke lag in einem Tal, das von den schwarzen Halden der Zechen umgeben war wie von düsteren Bergen. Die Stadt war ein Labyrinth aus engen Straßen, auf denen sich Menschen aller Nationen drängten: Polen, Litauer, Slowaken, Italiener, Iren - alle vereint im Kampf ums Überleben.
Jozef Krygier erwartete ihn am Bahnhof. Er war ein Mann in den Vierzigern, dessen Gesicht von der harten Arbeit unter Tage gezeichnet war wie eine Landkarte des Leids.
„Dzień dobry, Michale!“ rief Jozef Krygier, klopfte ihm auf die Schulter. „Cieszę się, że cię widzę. Witamy w piekle – willkommen in der Hölle.“
Das Haus der Krygiers war ein schmaler, zweistöckiger Holzbau, in dem drei Familien und fünf einzelne Kostgänger lebten. Michal bekam einen Schlafplatz in einem winzigen Zimmer unter dem Dach, das er mit zwei anderen polnischen Bergleuten teilte. Das Bett war eine einfache Strohmatratze, die Wände waren dünn, und nachts hörte er die Ratten in den Balken kratzen.
„Praca jest, Arbeit gibt es“, sagte Krygier. „Wenn du stark bist.“
„Wiesz, że jestem silny, Jozef. Du weißt, dass ich stark bin“, antwortete Michal und meinte es so.
Doch nichts hatte ihn auf das vorbereitet, was ihn erwartete.
Im Brecher: Zwischen Kohle und Verzweiflung
Die Arbeit im Brecher war kein Leben, sondern eine Prüfung, die darüber entschied, ob ein Mann ein Mensch blieb oder zu einer Maschine wurde. Zehn, zwölf Stunden am Tag saß Michal an den endlosen Fließbändern und sortierte Kohle mit bloßen Händen. Der Staub brannte in den Augen, legte sich auf die Zunge, kroch in die Lungen. Das Kreischen der Maschinen war so laut, dass man sich nur durch Zeichen verständigen konnte.
Seine Hände wurden rau und blutig, die Nägel rissen ab, die Finger verkrampften sich so sehr, dass er sie nachts kaum bewegen konnte. Manchmal blickte er auf diese Hände, die einst die Fallen im stillen Wald von Zdroje gestellt hatten, und fragte sich, ob er noch derselbe Mann war.
Die anderen Arbeiter waren wie er: Männer, die ihre Heimat verlassen hatten, um ihre Familien zu ernähren. Da war Stanisław aus Warschau, dessen Frau in Polen auf ihn wartete. Da war Piotr aus Litauen, der von seinem Sohn in Wilno träumte. Da war Pawel aus Wolhynien, der jeden Sonntag einen Brief nach Hause schrieb, den er nie abschickte, weil er nicht wusste, was er schreiben sollte.
„Jesteśmy wszyscy umarli, bracia… wir sind alle Tote“ sagte Pawel eines Tages, während sie in der kurzen Mittagspause ihr trockenes Brot kauten. „Wir starben, als wir Polskę opuścili. Teraz jesteśmy tylko duchy – jetzt nur noch Geister“
Michal schwieg, aber er wusste, dass Pawel recht hatte.
Abends, wenn er völlig erschöpft in das Haus der Krygiers zurückkehrte, aßen sie gemeinsam an einem langen Holztisch. Weronika Krygier, eine kleine, energische Frau, die ihre eigene Tragödie hinter einem tapferen Lächeln verbarg, kochte einfache, aber sättigende Mahlzeiten: Eintöpfe aus Kohl und Kartoffeln, manchmal ein Stück Speck oder Wurst.
Nach dem Essen lasen diejenigen, die lesen konnten, die Briefe vor, die aus der Heimat gekommen waren. Als im März 1904 ein Brief von Zofia eintraf, zitterten Michals Hände, während Krygier ihn vorlas:
„Mój kochany Michale, wir denken jeden Tag an dich. Pelusia fragt immer, wann der Tata zurückkommt. Ona już się modli – sie betet schon – und sagt deinen Namen dabei. Wladzia chodzi już – sie läuft – und ruft ‚Tata‘ durchs Haus…“
Michal senkte den Kopf tief über seinen Teller, damit niemand die Tränen sah, die über sein schmutziges Gesicht liefen.
Gefahr und Tod
Die Sirene der Zeche war das gefürchtetste Geräusch in Nanticoke. Ihr Heulen bedeutete Unglück, Katastrophe, Tod. Als am 2. November 1904 der Fahrkorb im Auchincloss-Schacht abstürzte und zehn Männer in die Tiefe riss, stand die ganze Stadt unter Schock.
Michal gehörte zu den Männern, die am Rand der Grube warteten, während die Leichen heraufgebracht wurden. Zehn Männer, die am Morgen noch gelebt, gelacht, gehofft hatten. Zehn Familien, die nun ohne Ernährer dastanden.
„Polacy“, flüsterte jemand neben ihm. „Unsere Leute.“
Einer der Toten war Stanisław aus Warschau, derselbe Stanisław, der am Fließband neben Michal gearbeitet und von seiner Frau geträumt hatte. Nun lag er da, zerbrochen wie eine Puppe, und sein Traum würde niemals in Erfüllung gehen.
Im Jahr 1905 kam eine neue Katastrophe: Typhus. Die Krankheit breitete sich aus wie ein unsichtbares Feuer, nährte sich von den schlechten hygienischen Bedingungen, dem kontaminierten Wasser, der Armut. Das Wasser aus den Pumpen der Stadt war verseucht, und wer es trank, spielte Russisches Roulette mit dem Tod.
In der Unterkunft der Krygiers husteten die Männer, fieberten, manche starben still in der Nacht. Michal blieb verschont, doch er wusste, dass der Tod in jeder Mahlzeit, in jedem Schluck Wasser lauerte.
Weronika Krygier flüsterte: „Bóg nas doświadcza – Gott prüft uns. Ale czemu tak ciężko? Warum so schwer?“ während sie die Stirn eines fiebernden Kostgängers mit kalten Tüchern kühlte.
Die Sehnsucht
Zweieinhalb Jahre vergingen wie ein endloser, grauer Winter. Michal arbeitete, sparte jeden Cent, schickte Geld nach Hause und ertrug die Einsamkeit, die an ihm nagte wie ein hungriges Tier.
Die Briefe aus der Heimat wurden seltener. Die Kosten für das Schreiben-lassen waren hoch, und oft wussten Zofia und er nicht, was sie einander mitteilen sollten außer der schlichten Tatsache, dass sie noch lebten, noch hofften, noch warteten.
In den Saloons von Nanticoke tranken die Männer ihren Kummer hinunter und redeten von der Heimat, als wäre sie ein verlorenes Paradies. Manche hatten beschlossen zu bleiben, ihre Familien nachzuholen, sich in Amerika eine neue Existenz aufzubauen. Andere träumten nur noch von der Rückkehr.
Michal gehörte zu den letzteren. Amerika hatte ihm Geld gegeben, aber es hatte ihm seine Seele genommen. Er sehnte sich nach den stillen Wäldern von Zdroje, nach dem Gesang der Vögel am frühen Morgen, nach dem Lächeln seiner Frau, nach den kleinen Händen seiner Töchter.
Im Sommer 1906, als die Hitze über der Kohlenlandschaft flimmerte wie in einem Hexenkessel, fasste er seinen Entschluss: Er würde nach Hause gehen.
„Jesteś szalony!“ sagte Pawel. „Hier gibt es Arbeit, Geld. Dort nur bieda.“
„Biedę znam“, entgegnete Michal. „Die Armut kenne ich. Ale tam – moja rodzina. Dort ist meine Familie.“
Die Rückreise: Heizer auf dem Atlantik
Am 29. August 1906 verabschiedete sich Michal von den Menschen, die zwei Jahre und sieben Monate lang seine amerikanische Familie gewesen waren. Weronika Krygier weinte beim Abschied. „Weź, Michale“, sagte sie und packte Brot und Speck ins Bündel. „Pozdrów Zofię ode mnie. Grüß Zofia von mir. Powiedz jej, że jej zazdroszczę – sag ihr, dass ich sie beneide.“
Die Rückreise sollte anders werden als die Hinfahrt. Michal hatte sich als Heizer verdingt - eine Arbeit, die noch härter war als alles, was er in den Brechern erlebt hatte, aber die ihm die Überfahrt bezahlte.
Im Kesselraum des Dampfers herrschten Temperaturen von über 50 Grad. Zwölf Stunden am Tag schaufelte er Kohlen in die glühenden Öfen, während der Schweiß in Strömen über seinen Körper lief und die Hitze ihm den Atem raubte. Seine Hände, die schon in den Brechern gelitten hatten, wurden zu blutigen Klumpen.
Aber jede Schaufel Kohle, die er in die Feuer warf, brachte ihn seiner Heimat näher. Jede Drehung der Schiffsschraube war ein Herzschlag auf dem Weg zurück zu Zosiu, zu Pelusia, zu Wladzia.
Nachts, wenn seine Schicht beendet war, lag er in der engen Koje und träumte von Zdroje. Er sah das kleine Holzhaus vor sich, den Garten mit den Kohlköpfen und Kartoffeln, die weiten Felder unter dem weiten Himmel Westpreußens.
Die Überfahrt dauerte zwölf Tage. Zwölf Tage zwischen Himmel und Hölle, zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Amerika und Europa.
Heimkehr
Am 16. September 1906 setzte Michal seinen Fuß wieder auf deutschen Boden. Hamburg kam ihm vor wie eine fremde Stadt - oder vielleicht war er selbst ein fremder Mensch geworden. Die Menschen auf den Straßen sprachen Deutsch, die Sprache des Landes, in das er zurückgekehrt war – doch sie klang ihm fremd, nach zweieinhalb Jahren Englisch und dem rauen Kauderwelsch der Kohlenlager.
Die Zugfahrt über Berlin, Posen und Thorn war wie eine Reise durch die Zeit. Mit jeder Meile, die der Zug zurücklegte, schälte sich die amerikanische Schicht von ihm ab wie alte Haut. Er wurde wieder zu dem Mann, der er einst gewesen war - nur reicher an Erfahrung und ärmer an Illusionen.
Als er in Radosk ausstieg und den vertrauten Weg nach Zdroje einschlug, war es früher Abend. Die Septembersonne stand tief über den Feldern, und die Luft roch nach Heu und getrocknetem Laub. Keine Spur von Kohlenstaub, kein Lärm von Maschinen, nur die ewige Stille der Ebene.
Er ging langsam, obwohl sein Herz vor Aufregung klopfte. Zweieinhalb Jahre waren eine lange Zeit. Seine Töchter würden ihn vielleicht nicht wiedererkennen. Pelagia war nun fast sechs Jahre alt, Wladislava vier. Sie hatten ohne ihn sprechen gelernt, laufen gelernt, leben gelernt.
Das Dorf lag vor ihm wie ein Bild aus einem Märchen. Die Dächer waren dieselben strohgedeckten Dächer, die er im Gedächtnis behalten hatte, die Felder lagen weit und still unter dem abendlichen Himmel.
Und dann sah er das kleine Haus. Sein Haus. Vor der Tür stand eine Frau - älter geworden, ernster, aber unverkennbar Zofia. „Michale…?“ flüsterte sie, unsicher. Er trat näher. „Zosiu… moja żono…“